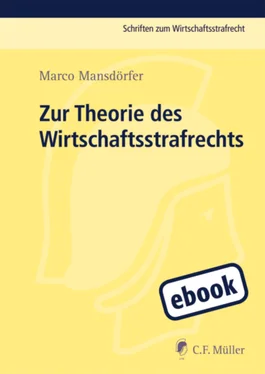4. Exemplifizierung am Hervorrufen von Sanktionsrisiken und das Einbehalten von Provisionen
a) Sanktionsrisiken
b) Provisionen und sonstige private Vorteile
5. Exemplifizierung zweckwidriger Ausgaben am Beispiel von Mäzenatentum sowie Sponsoring von Sport, Kunst und Kultur
a) Ansätze der Rechtsprechung zur strafrechtsdogmatischen Behandlung des Sponsorings
b) Kritik und Rückgriff auf die allgemeine Dogmatik des Untreuetatbestandes
c) Grundsätzliche Zulässigkeit des Sponsorings entsprechend den Bestimmungen des Geschäftsherrn
d) Konkretisierung durch die leges artis des Sponsorings
e) Grundzüge der leges artis des Sponsorings und strafrechtsdogmatische Konsequenzen
6. Exemplifzierung an unangemessenen Vergütungen und Prämien für Manager – insbesondere der Fall Mannesmann
a) Die Beurteilung des Falles durch das LG Düsseldorf
b) Kritik der Entscheidung unter Anwendung der zuvor entwickelten Grundsätze
c) Vergleich dieser Maßstäbe mit den tragenden Erwägungen der Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs
7. Exemplifizierung der Bedeutung von Verfahren – insbesondere Buchführungs-, Publizitäts-, Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten
a) Die zurückhaltende Position der Rechtsprechung
b) Allgemeine Grundsätze zur Behandlung von formellen Pflichtverletzungen
III. Die strafrechtliche Garantie hinreichend sicherer und möglichst ungehinderter Präferenzverfolgung als marktwirtschaftliches Kernstrafrecht
1. Die Garantie einer hinreichend sicheren Präferenzverfolgung durch den Schutz der Verlässlichkeit bestimmter Informationen
a) Exkurs: Die Bedeutung und das Wesen von Information als Wirtschaftsressource – Institutionentheoretische Begründung eines normativen Informationsbegriffs
b) Institutionenökonomische und wirtschaftsverfassungsrechtliche Postulate
aa) Institutionenökonomische Postulate – Senkung von Informationskosten, Sicherung eines standardisierten Informationsaustauschs, Markttransparenz
bb) Wirtschaftsverfassungsrechtliche Postulate – insbesondere BVerfGE 105, 252
c) Wirtschaftsstrafrechtliche Konsequenzen und weitere Exemplifizierungen
aa) Die Garantie der Verlässlichkeit bestimmter Informationen durch den Betrug gem. § 263 StGB und betrugsähnliche Vorschriften
bb) Die Garantie bestimmter Informationsgehalte und einer bestimmten Informationsbasis insbesondere durch Tatbestände des Nebenstrafrechts
2. Die Garantie einer möglichst ungehinderten Präferenzverfolgung durch den Schutz der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
a) Wirtschaftsverfassungsrechtliche und institutionentheoretische Postulate – Unterscheidung zwischen der Inanspruchnahme öffentlicher Güter und Knappheitssituationen, Beschränkung von Marktmacht und ungerechtfertigten Renditen
b) Strafrechtliche Konsequenzen insbesondere für das Verständnis der §§ 240, 253 StGB
aa)Die wirtschaftsstrafrechtlichen Grundkonstellationen: die allgemeine Garantie ungehinderter Präferenzverfolgung und die Garantie freier Marktteilhabe
(1) Der Ausschluss von öffentlichen Gütern
(2) Der Ausschluss von der Marktteilhabe
bb) Die Bedeutung des Autonomieprinzips
cc) Die Bedeutung des Prinzips der Selbstverantwortung
dd) Konkretisierung der Verwerflichkeitsprüfung durch die Schweretheorie und Entwicklung eines sachspezifischen Kriterienkatalogs
ee) Exemplifizierung und Hinweise zum Verständnis einiger Spezialtatbestände zum Schutz der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
IV. Die straf- und sanktionenrechtliche Flankierung der Marktordnung/Nicht-Marktordnung
1. Unmöglichkeit eines generalklauselartigen Schutzes der Wirtschaftsordnung; Konkurrenz wettbewerbsschützender Normen mit den individuellen Freiheitsgarantien
2. Das Sanktionenregime zum Schutz der Wettbewerbsordnung
a) Das Sanktionensystem zum Schutz des Wettbewerbs im Überblick
b) Vorschläge zur Lösung des auftretenden Konkurrenzproblems mit den strafrechtlichen Garantien der Individualfreiheiten
c) Der Begriff des Wettbewerbs als zentraler Ansatzpunkt für die Entwicklung systemadäquater Entscheidungen
aa) Wirtschaftstheoretische Begriffsanalyse
bb) Strafrechtliche Bedeutung der Einzelelemente des Wettbewerbsbegriffs
d) Konsequenzen für das Verständnis insbesondere der §§ 298 und 299 StGB – Wettbewerbsschutz als Sicherung der Verteilungsgerechtigkeit und individueller Freiheit
aa) Konkretisierungen des Rechtsguts Wettbewerb in § 298 StGB – Abgrenzung zum Rechtsgut Vermögen, Verhältnis zu § 263 StGB und Deliktscharakter
bb) Die Legitimation des § 298 StGB als Kriminalstraftatbestand und das Verhältnis zu anderen Kartellordnungswidrigkeiten
cc) Die tatbestandsimmanente Logik des § 298 StGB – insbesondere die tatbestandlich erfassten Vergabeverfahren
dd) Das Rechtsgut Wettbewerb bei § 299 StGB – zugleich zur ökonomischen Analyse des Begriffs der Korruption und dessen Bezug zur individuellen Freiheit
e) Unterschiede in der Sanktionierung von Wettbewerbsbeschränkungen und Unlauterkeiten im Wettbewerb
3. Regelungsregime zur Flankierung besonders regulierter Wirtschaftsfelder und des Arbeitsmarktes
a) Die Strafbarkeit der missbräuchlichen Erlangung oder Verwendung von Subventionen
b) Sanktionenrechtliche Flankierung der sozialstaatlichen Arbeitsmarktordnung
c) Zwischenfazit
4.Das Regelungsregime zur Sicherung einer kontrollierten Außenwirtschaft
a) Die grundlegende Ausgestaltung des Rechts der Außenwirtschaft de lege lata
b) Interpretation des Außenwirtschaftsstrafrechts als Garantie individueller Wirtschaftsfreiheit
V. Die soziale Risikoordnung als „äußere“ Rahmenordnung des Wirtschaftsstrafrechts
1. Das grundsätzliche Maß des allgemeinen Rechtsgüterschutzes gegenüber Beeinträchtigungen durch ökonomisches Handeln
2. Rechtstechnische Rezeption der sozialen Risikoordnung auf der sekundären Ebene des Straf- und Sanktionenrechts
a) Situationsbezogene Sondernormen zum Schutz vor bestimmten Einzelgefahren
b) Genereller Schutz durch Anwendung kernstrafrechtlicher Generalklauseln – Exemplifzierung an Beispielen aus dem Arztrecht und dem Produktstrafrecht
3. Die dogmatische Integration des wirtschaftlichen Handelns in die äußere Risikoordnung
a) Substitution exakter Zurechnungskriterien durch weichere Mechanismen bei Handlungen aus einem Unternehmen (betriebsbezogene Betrachtungsweise)
b) Substitution exakter Zurechnungskriterien durch weichere Mechanismen bei der Bestimmung der abzuurteilenden Handlung, des Zurechnungszusammenhangs, des entstandenen Schadens und der Schuld
c) Fehlerspezifisch prozessorientierter Ansatz des Gesetzgebers im Nebenstrafrecht
d) Zusammenfassung und Kritik
B. Individuelle Risikoschaffung in komplexen wirtschaftlichen Funktionszusammenhängen
I. Institutionentheoretische Begründung der Zusammenarbeit Einzelner in komplexen Organisationen und Unternehmen sowie erste normative Aussagen
II. Das Zusammenwirken mehrerer als Gegenstand der aktuellen juristischen Diskussion
1. Implizites Konzept der herrschenden Auffassung: Das Unternehmen als Gesamtorgan mit hierarchischer Binnenstruktur
2. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Leitungsebene
a) Das richterrechtlich entwickelte Pflichtenprogramm der Allzuständigkeit und der Generalverantwortung und seine Konkretisierungen
aa) Umfang und Grenzen der Pflichtendelegation
bb) Konkretisierung für Entscheidungen innerhalb von Führungsgremien
cc) Konkretisierung für Situationen des Ausscheidens aus und des Eintritts in Unternehmen
dd) Einzelfallkonkretisierung des Pflichtenprogramms durch den Gesetzgeber und die Rechtsprechung – Beispiele
Читать дальше