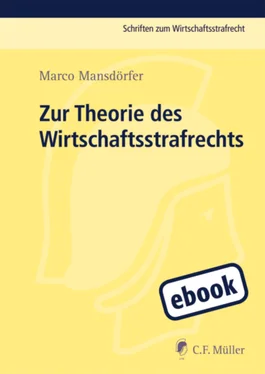Vorwort Vorwort Das Wirtschaftsstrafrecht entwickelt sich derzeit mit einer Dynamik, wie ich sie im Strafrecht noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten habe. Schon die Verfasser des Alternativ-Entwurfs zum Wirtschaftsstrafrecht 1977 haben das Potential des Wirtschaftsstrafrechts zwar gesehen; erst die höchstrichterliche Rechtsprechung der 1990er Jahre und des neuen Jahrtausends hat die Kraft des Wirtschaftsstrafrechts dann aber endgültig entfaltet. Die Aufgabe der Wissenschaft wird es sein, diese Kraft in geordnete und mäßigende Bahnen zu lenken. Ich möchte hierzu – in Wissenschaft und Praxis – meinen Beitrag leisten. Die wesentlichen Überlegungen zu diesem Buch waren im Jahr 2007 abgeschlossen. Im Februar 2010 wurde die Arbeit von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als Habilitation angenommen und sodann für die Drucklegung – soweit möglich – aktualisiert. Mein Dank gilt Professor Dr. Wolfgang Frisch für die Betreuung der Arbeit sowie Professor Dr. Roland Hefendehl für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Ganz herzlich danken möchte ich aber meiner Familie und meinen Freunden, die mir während der Zeit der Habilitation zur Seite gestanden haben. Johannes, Dominik, Sven und Holger – vielen Dank! Dieser Band markiert zugleich den Beginn der Verlagsreihe „Schriften zum Wirtschaftsstrafrecht“. Ich danke den Herausgebern und Professoren Thomas Rotsch , Mark Deiters und Mark Zöller und dem Verlag – namentlich Herrn Rechtsanwalt Jürgen Frenke – für die hiermit verbundene Ehre, hoffe, der daraus resultierenden Hypothek gerecht zu werden und wünsche Ihnen viel Erfolg. April 2011 Freiburg im Breisgau Marco Mansdörfer Andrea Maria
Teil 1 Teil 1 Grundlagen zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts Teil 1 Grundlagen zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts › A. Einführung: Wirtschaftsstrafrecht im Übergang?
Grundlagen zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts Teil 1 Grundlagen zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts Teil 1 Grundlagen zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts › A. Einführung: Wirtschaftsstrafrecht im Übergang?
A. Einführung: Wirtschaftsstrafrecht im Übergang?
B. Der Begriff des Wirtschaftsstrafrechts und der individualistische Ausgangspunkt für ein sachangemessenes Verständnis des Wirtschaftsstrafrechts
I. Der Begriff „Wirtschaftsstrafrecht“
1.Primär rechtstheoretisch orientierte Systematisierungsversuche
a) Der frühe am Schutz der Volkswirtschaft ausgerichtete Systematisierungsversuch von Lindemann
b) Die „Straftaten gegen die Wirtschaft“ im Alternativ-Entwurf zum Wirtschaftsstrafrecht 1977
c) Die Unterscheidung von Delikten zum Schutz von Volks-, Betriebs- und Finanzwirtschaft bei Lampe
d) Wirtschaftsstraftaten als Delikte zum Schutz der Wirtschaftsordnung bei Otto und Tiedemann
2. Primär rechtspraktisch orientierte Systematisierungsversuche
a) Die betriebsbezogene Unterscheidung bei Müller-Gugenberger/Bieneck nach Pflichtverstößen bei der Gründung, beim Betrieb sowie bei der Beendigung eines Unternehmens
b) Die Einteilung des Wirtschaftsstrafrechts in vier Hauptrisikobereiche bei Eidam
c) Die topische, an einzelnen Kriminalitätsbereichen orientierte Einteilung bei Achenbach/Ransiek
II. Folgen der vorgestellten Definitionsversuche und eine erste Kritik
III. Eigener Ansatz: Entwicklung eines Wirtschaftsstrafrechts auf der Grundlage eines methodologischen Individualismus
1. Betrachtung des Wirtschaftsstrafrechts aus methodisch individualistischer Perspektive – Definition und Überlegungen zu Möglichkeiten einer strafrechtsimmanenten Konkretisierung des Ansatzes
2. Konkretisierung des eigenen Ansatzes durch einen Rückgriff auf institutionenökonomische Erkenntnisse
a) Die Grundidee institutionenökonomischer Wirtschaftstheorie und ihr methodologischer Individualismus
b) Der Ausgangspunkt beim homo oeconomicus
aa) Kritik am Menschenbild der Ökonomik
bb) Sachgründe für das Bild des homo oeconomicus als Arbeitsmodell
cc) Konkretisierung des Bildes des homo oeconomicus als Erklärungsmodell
dd) Normprägende und normkritische Funktion sowie Grenzen des ökonomischen Menschenbildes
c) Aufnahme von Bezügen zu sonstigen Lebensbereichen – Hinweise auf die besondere Rolle des Wirtschaftsverfassungsrechts
3. Konsequenzen des eigenen Ansatzes für die nachfolgenden Überlegungen
C. Die Konvergenz ökonomischer und strafrechtlicher Steuerungsmechanismen als grundlegende theoretische Voraussetzung des Wirtschaftsstrafrechts
I. Ökonomische Steuerungsmechanismen
1.Das Ergiebigkeitsprinzip als dominierendes Steuerungsprinzip
a) Das Ergiebigkeitsprinzip im engeren Sinne – Inhalt, empirisch-personale Seite, theoriekonstitutive Bedeutung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften
b) Grundsätzliche Legitimation des Ergiebigkeitsprinzips – das Ergiebigkeitsprinzip als offenes Prinzip, theoretische Basis eines entsprechenden Verständnisses, Legitimation durch implizite Bezugsgrößen des Ergiebigkeitsprinzips und die Rezeption externer Bezugsgrößen
c) Das offene Ergiebigkeitsprinzip in seiner praktischen Umsetzung – Ergänzung des Ergiebigkeitsprinzips um Entscheidungsregeln für dynamische Situationen und für ein Handeln unter unvollkommener Information
2. Konkretisierung des Ergiebigkeitsprinzips als Handlungsmaxime bei Unsicherheit (normative Entscheidungstheorie)
3. Konkretisierung für dynamische Situationen des Tauschs, des Wettbewerbs und des Eingreifens Dritter (Spieltheorie)
a) Gegenstand der Spieltheorie
b) Spieltheoretische Grundsituationen und die situationsspezifische Bedeutung von Strafe
c) Bewusste Gestaltung von Handlungssituationen im Wege des Mechanismusdesigns
4. Konkretisierung für Situationen der Unternehmensleitung (Führungslehre)
a) Grundsätzliche managementtheoretische Methoden
b) Unternehmensindividuelle Profilierung der konkreten Unternehmensstrategie und -philosophie
c) Das Unternehmen Robert Bosch als Beispiel einer als funktionelles Sozialsystem organisierten Wirtschaftseinheit
5. Defizite formaler Organisation als Unorganisiertheit?
a) Die Bedeutung der Fragestellung
b) Unorganisiertheit versus informelle Organisation
c) Die Figur des „psychologischen Vertrags“
d) Das Problem der Integration der Subsysteme in das Gesamtsystem
e) Informelle Organisation als notwendige Ergänzung formaler Organisation
f) Beeinflussung informaler Organisationsstrukturen
II. Strafrechtliche Steuerungsmechanismen
1.Die Strafe als elementarer strafrechtlicher Steuerungsmechanismus
a) Gegenstand und Begriff der Strafe
b) Votum für ein extensives Begriffsverständnis – Bestimmung des dominierenden Strafzwecks nach der konkreten Art der Tat
c) Auseinandersetzung mit naheliegender Kritik
2. Die besondere Bedeutung des Handlungsunrechts gegenüber dem Erfolgsunrecht bei der Begründung von Strafe
3. Die Steuerungsfunktion des Tatbestandes
a)Analyse der Steuerungsmechanismen des Verletzungsdelikts
aa) Verletzungsdelikte als Verbote jeglicher zurechenbarer Rechtsgutsverletzung
bb) Beschränkung der Sanktionierung fahrlässiger Gefahrschaffungen auf überragende Rechtsgüter
cc) Beschränkung auf rechtlich missbilligte und sich aufdrängende Gefahrschaffungen im Übrigen – besondere Problematik subjektiver Beschränkungen im Wirtschaftsstrafrecht
dd) Vorverlagerungen der Steuerungswirkung durch die Strafbarkeit des Versuchs – Besonderheiten in wirtschaftsstrafrechtlichen Fallkonstellationen
ee) Die Erweiterung der Strafbarkeit über den unmittelbar Handelnden hinaus auf weitere Personen – grundlegende Besonderheiten des Wirtschaftsstrafrechts
Читать дальше