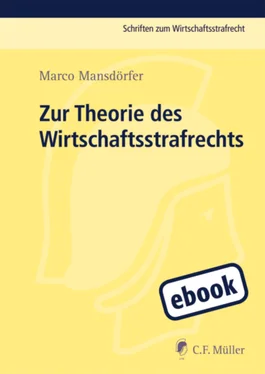a) Die Bedeutung der Fragestellung
105
Wer die Konvergenz ökonomischer und rechtlicher Steuerung untersuchen will, kann diese Fragen aus mehreren Gründen nicht übergehen: Die Antwort auf diese Fragen spezifiziert zunächst das Ausmaß der Dominanz des Ergiebigkeitsprinzips und der daraus resultierenden Steuerung in der tatsächlichen betrieblichen Praxis. Sollte sich herausstellen, dass diese Dominanz Lücken aufweist, liefert die Antwort möglicherweise Hinweise darauf, ob im Bereich der Wirtschaft jenseits der „rein ökonomischen Steuerungsmechanismen“ noch andere spezifische Wirkmechanismen – wie zum Beispiel individuelle Autorität, Gruppendynamik, Tradition etc. – erkannt werden können. Diese müssen dann vom Strafrecht mit erfasst werden und gegebenenfalls müssen gerade hierauf bezogene Normen und Institutionen entwickelt werden. Vielleicht müssen aber auch nur generelle Steuerungsmechanismen – insbesondere auch die Sanktionen – auf diese Phänomene hin spezifiziert werden und so ausgestaltet werden, dass sie derartige Wirkmechanismen in dem Maß destabilisieren, wie sie dem Recht als der verbindlich vorgegebenen Ordnung widersprechen.
b) Unorganisiertheit versus informelle Organisation
106
Die Grundlage für eine wissenschaftlich fundierte Antwort auf diese Fragen bilden die tatsächlichen Vorgänge innerhalb eines Unternehmens, genauer: die einem Unternehmen per se eigenen Automatismen. Diese wurden in jüngerer Zeit vor allem von der aus der Betriebspsychologie hervorgegangenen, systemorientierten Organisationspsychologie untersucht[228]. Die Psychologie erkannte, dass die Organisation für jedes Individuum – gleich ob Arbeiter, Angestellter oder Manager – ein eigenständiges psychologisches Faktum darstellt, auf das der Einzelne reagiert[229].
107
Bereits dieses Herkommen macht es begreiflich, dass die von der Organisationspsychologie verwendete Definition der Organisation als allgemeiner Begriff den von der Betriebswirtschaft entwickelten Begriff der Unternehmung mit umfasst: Organisation ist danach jede nach rationalen Gesichtspunkten erfolgende Koordination der Aktivitäten einer Anzahl von Menschen mit dem Zweck, ein gemeinsames, explizit genanntes Ziel vermittels der Aufteilung von Arbeit und Funktionen sowie vermittels einer funktional geordneten Autorität und Verantwortlichkeit zu erreichen[230].
108
Als Objekt der Koordination stehen nach obiger Definition also Aktivitäten von Menschen im Zentrum der Betrachtungen. Die konkrete Koordination kann einerseits schriftlich dokumentiert und in einem Koordinationsplan fixiert werden. Sie kann dann nur seitens der obersten Autorität neu definiert werden (sog. formale Organisation). Sie kann sich andererseits aber auch beiläufig ergeben, ohne ausdrücklich geplant zu sein (sog. informelle Organisation)[231]. Viele für eine Organisation oder Unternehmung entscheidende Vorgänge entstehen gerade aus einem Zusammenspiel formaler und informeller Organisation[232].
c) Die Figur des „psychologischen Vertrags“
109
Mitarbeiter und Organisation schließen daher neben dem rechtlichen Arbeitsvertrag einen geradezu „psychologischen Vertrag“, mit dessen Hilfe über rein materielle Anreizsysteme auch die wesentlichen psychologischen Verhaltensdeterminanten fixiert werden[233]. Gegenstand des „psychologischen Vertrages“ sind einerseits die vielfältigen Erwartungen, mit denen das Individuum der Organisation gegenübertritt, und andererseits die Erwartungshaltung, die die Organisation gegenüber dem Individuum einnimmt. Aus der Sicht der Organisation wird der psychologische Vertrag durch das Konzept der Autorität erfüllt[234]. Der Abschluss dieses „psychologischen Vertrags“ verlangt vom Einzelnen die Bereitschaft, sich dem Autoritätssystem dieser Organisation zu unterwerfen.
110
Dieses Autoritätssystem basiert im Gegensatz zu einem Machtapparat auf der Freiwilligkeit seitens des Mitarbeiters. Basis dieser Legitimation sind sowohl Traditionen, wie zum Beispiel die Leitung eines Unternehmens durch eine Familiendynastie, als auch rational-legale Gründe. Beispiele sind etwa die aus einer Stabsorganisation folgende Weisungskompetenz der übergeordneten gegenüber der untergeordneten Ebene oder Charisma als besondere persönliche Fähigkeit[235]. Ob es eine rein rationale Basis von Autorität und damit eine Basis von Autorität geben kann, die allein auf Fachkompetenz beruht, ist dagegen zweifelhaft. Der Fachkompetenz scheint maßgebliche Bedeutung vor allem als notwendige Ergänzung für rational-legal begründete Autorität zuzukommen[236]. Diese Faktoren bilden damit zugleich die Grundlage dafür, dass der psychologische Vertrag eingehalten wird. Schein stellt daher die Prognose auf, der Mitarbeiter werde kündigen, sobald eine Organisation nicht mehr den Erwartungen des Mitarbeiters entspreche und dieser andererseits nicht gezwungen werden könne, Mitarbeiter der Organisation zu bleiben[237].
d) Das Problem der Integration der Subsysteme in das Gesamtsystem
111
Die wirtschaftliche Unternehmung kann angesichts der für sie typischen Arbeitsteilung als ein System von Zweck-Mittel-Ketten verstanden werden. Dieses Bild verschiedener Zweck-Mittel-Ketten, die sich als Subsysteme zu dem Gesamtgebilde der Unternehmung zusammensetzen, macht die Grenzen deutlich, die der formalen Organisation solcher Systeme gesetzt sind: Die formale Organisation muss sich auf eine Grundsatzplanung beschränken, die den verschiedenen Einheiten eine hinreichende Selbstständigkeit einräumt, damit diese die von ihnen vorgegebenen Ziele optimal erreichen können. Die Aufgabenbereiche der verschiedenen Subsysteme können sich daher partiell überschneiden und die Subsysteme selbst können miteinander in Konkurrenz treten – z. B. um fähige Mitarbeiter, um den Nutzungsvorrang bei wichtigen Maschinen oder um Mittel zur Entwicklung neuer Produkte[238]. Je größer eine Organisation ist, desto bedeutsamer werden diese Effekte, sodass die Subsysteme zunehmend unvollständig in die Gesamtorganisation integriert sind.
112
Ein wesentlicher Grund, dass solche Integrationsmängel entstehen, sind außerdem die bereits angesprochenen informellen Organisationsmuster innerhalb eines Unternehmens[239]. Sie können bedingen, dass einzelne Personen oder Gruppen eine größere Loyalität gegenüber einer Teilorganisation als gegenüber der Gesamtorganisation aufweisen, sodass der Organisationsplan an praktischer Verbindlichkeit verliert. Umgekehrt können im Wege der informellen Organisation auch Lücken und Probleme geschlossen werden, die sich aus einer defizitären formalen Organisation ergeben[240].
113
Insgesamt folgt damit aus einer defizitären Integration der Subsysteme in die Gesamtorganisation die Gefahr, dass daraus entstehende oder von Beginn an bestehende Probleme erst spät oder im Einzelfall möglicherweise zu spät erkannt werden können, um Schäden abzuwenden. Eine richtige Organisation verlangt daher nicht nur eine sachangemessene formale Organisation, sondern auch Rücksicht auf die innerhalb der einzelnen Subsysteme wirkenden psychologischen Faktoren sowie eine ausreichende Kommunikation innerhalb der Gesamtorganisation[241]. Gerade dies ermöglicht es oft erst wieder, die einzelnen Subsysteme für die Interessen der anderen Teilgruppen sowie der Gesamtorganisation zu sensibilisieren[242].
e) Informelle Organisation als notwendige Ergänzung formaler Organisation
114
Um das Verhältnis formaler und informeller Organisation vollständig beurteilen zu können, müssen abschließend noch weitere Besonderheiten berücksichtigt werden: So hängt das Verhältnis von formaler und informeller Organisation in besonderem Maß von der Art der Technologie und der Dynamik des Umfelds eines bestimmten Produktionsbereiches ab. Die Art des Funktionsprozesses determiniert, wie viele Ebenen eine Organisation braucht und wie weit die Kontrollspanne des Vorgesetzten reicht[243]. So bauen etwa leistungsfähige Unternehmen bei starken Bewegungen im Umfeld tendenziell starre formale Organisationsformen ab und ersetzen diese durch flexiblere informale Strukturen[244].
Читать дальше