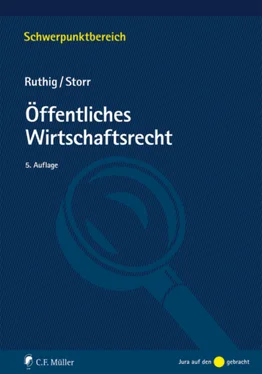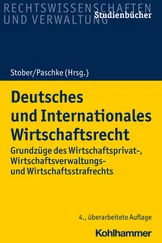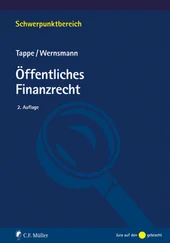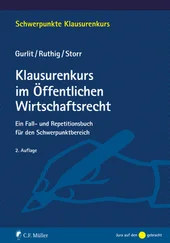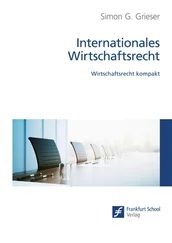1. Referenzgebiete und Rechtsgrundlagen
a) Regulierungsrecht als richtliniengeprägtes Recht
b) Rechtsgrundlagen des nationalen Regulierungsrechts
2.Europäisierte Wirtschaftsregulierung
a) Europäisierung als Publifizierung
b) Europäisierung als Ökonomisierung
c) Europäisierung als Zuständigkeitsverlagerung: Vom transnationalen Verwaltungsakt zu europäischen Regulierungsagenturen
3. Ziele staatlicher Regulierung
a) Schaffung von Wettbewerb
b) Sicherstellung der Versorgung
c) Verbraucher- bzw Kundenschutz
d) Die rechtliche Bedeutung von Regulierungszielen und –grundsätzen
II. Verwaltungs- und verwaltungsprozessuale Grundlagen
1.Gegenstände und Instrumente
a) Präventive Kontrolle von Marktzutritt, Marktverhalten und Organisation
b) Informationsgenerierung
2. Handlungsformen
a) Verwaltungsakte
b) Administrative Normsetzung und Verwaltungsvorschriften
3.Rechtsschutz
a) Öffentlichrechtliche Streitigkeiten
b) Die Sonderzuweisung im Energierecht: Die Beschwerde nach § 75 EnWG
aa) Statthaftigkeit
bb) Beschwerdeberechtigung (Abs. 2) und Beschwer
c)Gerichtliche Kontrolldichte
aa) Das sog. Regulierungsermessen
bb) Beschränkung der Beurteilungsgrundlage durch den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im gerichtlichen Verfahren
III. Die Regulierung des Marktzutritts
1. Entwicklungslinien: Von der Bedürfnisprüfung zu staatlichen Allokationsentscheidungen
2.Anzeigepflichten
a) Telekommunikationsunternehmen (§ 6 TKG)
b) Anzeige der Energiebelieferung von Haushaltskunden (§ 5 EnWG)
3.Genehmigungspflichten
a) Betrieb eines Energieversorgungsnetzes (§ 4 EnWG)
b) Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute (§§ 1, 32–38 KWG)
aa) Die geschäftsbezogene Anknüpfung der Erlaubnispflicht (§ 1 Abs. 1, 1a KWG)
bb) Der Inlandsbezug und Internet-Sachverhalte
cc) Entscheidungen nach § 4 KWG
dd) Befreiung nach § 2 Abs. 4 KWG
ee) Maßnahmen bei nicht erlaubtem Betreiben von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen
ff) Exkurs: Der Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen
c) Die Frequenzvergabe als Beispiel einer staatlichen Allokationsentscheidung
aa) Das Verteilungsverfahren bei Frequenzknappheit
bb) Insbes: Versteigerung als Verwaltungsverfahren
cc) Rechtsschutz nach Abschluss des Versteigerungsverfahrens
dd) Rücknahme und Widerruf
IV. Zugangsregulierung und Preisregulierung in EnWG und TKG
1. Zugangs- und Entgeltregulierung als ökonomisches Herzstück des Regulierungsrechts
2. Regulierung des Netzzugangs nach dem EnWG
3.Die Zugangsregulierung im TKG
a) Die Flexibilisierung staatlicher Kontrolle: Sektorspezifische und asymmetrische Marktregulierung
b) Zugangsregulierung und Entgeltregulierung als Kontrollmechanismen gegenüber marktmächtigen Unternehmen
4. Grundzüge der Entgeltregulierung
a)Grundlagen der Preisbildung
aa) Kosten der effizienten Leistungserbringung
bb) Anreizregulierung
b) Formen staatlicher Preisregulierung
aa) Das TK-Recht: Die Genehmigung von Entgelten für Zugangsleistungen (§ 30 ff TKG)
bb) Das Energierecht
c) Marktmechanismen zur Preisbestimmung: der Frequenzhandel
V. Die laufende Überwachung der Geschäftstätigkeit mittels Generalklauseln
1. „Besondere“ Missbrauchsaufsicht in TKG und EnWG
2. Generalklauseln
3. Aufsicht im öffentlichen Interesse? – Amtshaftung und Ansprüche auf Einschreiten
§ 7 Das Recht der Privatisierung
I. Das Phänomen „Privatisierung“
1. Die formelle Privatisierung
2. Die materielle Privatisierung
3. Die funktionale Privatisierung
II.Rechtsfragen der Privatisierung
1. Privatisierung und Wirtschaftlichkeit
2. Das Kooperationsrechtsverhältnis
3. Privatisierung und Verfassung
4. Steuerung und Verantwortung
5. Privatisierungsrechtlich relevante Verwaltungsrechtsinstitute
a) Beleihung
b) Verwaltungshilfe
c) Konzession
6. Privatisierung im europäischen Rechtsrahmen
§ 8 Das Recht der öffentlichen Unternehmen
I.Die öffentlichen Unternehmen
1. Historischer Überblick und Privatisierung
2. Wirtschaftspolitische Einordnung öffentlicher Unternehmen
3.Begriffsbestimmung
a) Zum Begriff „Unternehmen“
b) Öffentliche Unternehmen
c) Eigengesellschaften
d) Gemischt-wirtschaftliche Unternehmen
e) Öffentlich-rechtliche Unternehmen
II.Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für öffentliche Unternehmen
1. Wirtschaftspolitische Neutralität des Grundgesetzes
2.Öffentliche Unternehmen als Träger von Grundrechten?
a) Keine Gewerbefreiheit der öffentlichen Hand
b) Zum Grundrechtsschutz gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen
c) Die Bedeutung der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung für kommunale Unternehmen
3.Öffentliche Unternehmen als Adressaten der Grundrechte
a) Grundrechtsbindung
b) Die Wettbewerbsfreiheit
c) BVerwG: Grundrechtseingriff nur bei Monopolisierung und Verdrängungswettbewerb
d) BVerfG: Mangelnde Eingriffsqualität bei marktkonformem Verhalten der öffentlichen Hand
e) Wettbewerb als Interaktion: der mittelbare Grundrechtseingriff
f) Konsequenzen der Grundrechtsrelevanz öffentlicher Unternehmen
4. Zulässigkeitsvoraussetzungen für öffentliche Unternehmensbeteiligungen
a) Wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Unternehmen
b) Das Erfordernis eines öffentlichen Zwecks
c) Geeignetheit der Aufgabenauslagerung auf Unternehmen
d) Art und Umfang des Unternehmens in Abhängigkeit zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf
e) Die Subsidiaritätsbestimmung
5. Öffentlich-rechtliches und privatrechtliches Gesellschaftsrecht
a) Die Präferenz der öffentlichen Hand für privatrechtliche Gesellschaftsformen
b) Beteiligung der öffentlichen Hand an Unternehmen in Privatrechtsform
c) Das Verwaltungsgesellschaftsrecht
d) Das Kommunalunternehmen
III.Die europarechtlichen Rahmenbedingungen für öffentliche Unternehmen
1. Grundsätzliche Einordnung öffentlicher Unternehmen
2. Öffentliche Unternehmen und Grundfreiheiten
3.Öffentliche Unternehmen als Dienstleister im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse
a) Das Privilegierungsverbot des Art. 106 Abs. 1 AEUV
b) Die Sicherstellung der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Binnenmarkt nach Art. 106 Abs. 2 AEUV
§ 9 Subventions- und Beihilfenrecht
I.Das Subventionsrecht
1. Überblick
2.Der Subventionsbegriff
a) Übersicht über mögliche Begriffsbestimmungen
b) Der Subventionsgeber
c) Der Subventionsempfänger
d) Die Subventionsleistungen
e) Zur Anforderung „ohne marktmäßige Gegenleistung“
f) Förderung öffentlicher Zwecke
3. Die Grundlagen der Subventionsvergabe
a) Zuständigkeit zur Subventionsvergabe
b) Rechtsgrundlage für Verschonungssubventionen und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers
c) Rechtsgrundlage für Finanzhilfen und Entscheidungsrahmen der Behörde
d) Zur Änderung der Förderbedingungen durch die Behörde
e) Zur rechtlichen Qualifikation des Subventionsvergabeverfahrens
f) Die Subventionskontrolle
g) Rechtsschutz durch Konkurrenten
4. Die Änderung und Aufhebung von gesetzlich geregelten Verschonungssubventionen
5. Der Widerruf von rechtmäßig bewilligten Subventionen wegen Zweckverfehlung
a) Anwendungsbereich von § 49 VwVfG
b) Der zu widerrufende Bewilligungsbescheid
c) Der Tatbestand der Zweckverfehlung
d) Das intendierte Widerrufsermessen
Читать дальше