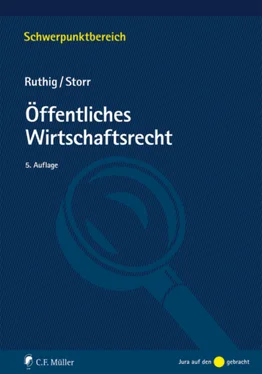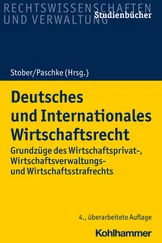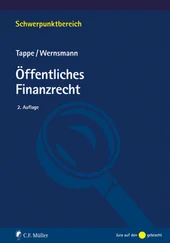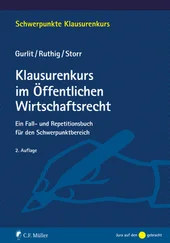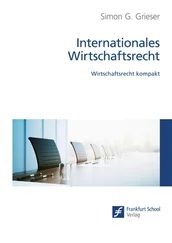§ 3 Das Gewerberecht
I.Grundstrukturen und Grundbegriffe
1. Gewerberecht als Grundmodell des öffentlichen Wirtschaftsrechts
2.Das Regelungskonzept der GewO
a) Gewerbearten
b) Erlaubnisfreies und zulassungspflichtiges Gewerbe
c) Gewerberechtliche Schlüsselbegriffe
3. Der Begriff des Gewerbes
a) Erlaubtheit des Gewerbes
b) Gewinnerzielungsabsicht
c) Dauerhaftigkeit
d) Selbstständigkeit
e) Keine Urproduktion
f) Kein freier Beruf
g) Keine Verwaltung eigenen Vermögens
4.Der Gewerbetreibende
a) Juristische Personen und Personengesellschaften als Gewerbetreibende
b) Stellvertretung im Gewerberecht
c) Die Strohmannproblematik
5. Die grenzüberschreitende Gewerbeausübung von EU-Ausländern
a) Einschränkung der Anzeige- und Genehmigungspflichten
b) Umgehungsverbote
c) Begriff der Niederlassung
d) Die Zuständigkeit deutscher Behörden für ein Einschreiten
6.Die gewerberechtliche Unzuverlässigkeit
a) Der Begriff und seine Funktion
b) Gesamtbild und Tatsachengrundlage
c) Unzuverlässigkeit beim Verstoß gegen gewerbebezogene Vorschriften
d) Verstöße gegen Strafvorschriften ohne unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gewerbe
e) Fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
f) Förderung der Unsittlichkeit
g) Sonstige Tatsachen
h) Zuverlässigkeit und Sachkunde
i) Vertiefung: Persönlicher Anknüpfungspunkt der Unzuverlässigkeitsprüfung
7.Zuständigkeit und Verfahren
a) Sachliche und örtliche Zuständigkeit
b) Einheitliche Stelle
c) Genehmigungsfiktion
II.Die Kontrolle des stehenden Gewerbes
1. Anzeige der Aufnahme eines stehenden Gewerbes (§ 14 GewO)
a) Umfang der Anzeigepflicht
b) Die Aufforderung zur Abgabe der Gewerbeanzeige
c) Verweigerung der Bestätigung der Gewerbeanzeige
2. Die Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit (§ 35 GewO)
a) Ausübung eines erlaubnisfreien, stehenden Gewerbes
b) Tatsachen, die die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden oder eines Betriebsleiters begründen
c) Verhältnismäßigkeit der Maßnahme
d) Rechtsfolgen
e) Die Gewerbeuntersagung gegenüber Vertretungsberechtigten bzw Betriebsleitern
3. Die Zulassung (erlaubnispflichtiger) gewerblicher Tätigkeiten (§§ 30–34e GewO)
a) Beispiele für erlaubnispflichtige Gewerbe
b) Die gewerberechtliche Erlaubnis
c) Erlöschen der Erlaubnis, insbesondere durch Widerruf
d) Einschreiten gegen nicht erlaubte (aber erlaubnispflichtige) Betriebe
e) Sonderfall: Zulässigkeit einer Maßnahme nach § 15 Abs. 2 GewO bei bloß formeller Illegalität?
f) Feststellende Verwaltungsakte
4.Gewerberecht und allgemeines Polizeirecht am Beispiel des genehmigungsbedürftigen Gewerbes
a) Einschreiten gegen einzelne Formen der Gewerbeausübung
b) Einschreiten gegen gewerberechtlich unzulässige Tätigkeiten
5. Die Vollstreckung gewerberechtlicher Verwaltungsakte
a) Die einzelnen Zwangsmittel
b) Das Verhältnis von Zwangsvollstreckung und Grundverfügung
c) Die Vollstreckung ohne zugrundeliegende Grundverfügung (sofortiger Vollzug)
6. Auskunft und Nachschau (§ 29 GewO)
a) Auskunft
b) Nachschaurechte
III. Das Reisegewerbe (§§ 55 ff GewO)
1.Erscheinungsformen des Reisegewerbes
a) Die gesetzliche Definition
b) Ohne vorhergehende Bestellung
c) Außerhalb der Niederlassung
d) Reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten
2.Die Reisegewerbekarte
a) Allgemeines
b) Die Erteilung der Reisegewerbekarte
c) Widerruf
d) Betreiben eines Gewerbes ohne die erforderliche Reisegewerbekarte
IV. Die Zulassung von Märkten (§§ 64 ff GewO)
1. Anwendungsbereich der Vorschriften
a) Festsetzungsfähige Veranstaltungen
b) Veranstalter
c) Die Marktprivilegien
2.Die Festsetzung eines Marktes
a) Rechtsnatur der Festsetzung und Rechtsschutz
b) Versagungsgründe
3. Das Recht auf Teilnahme an festgesetzten Veranstaltungen
a) Vergabekriterien in Knappheitssituationen
b) Konsequenzen für das Verwaltungsverfahren
c)Rechtsschutzfragen
aa) Rechtsnatur der Rechtsbeziehungen zwischen Veranstalter und Marktteilnehmer und Rechtsweg
bb) Die in Betracht kommenden Klagearten
4. Märkte und Volksfeste als kommunale Einrichtungen
V. Gewerbeordnung und E-Commerce
1. Gewerberecht und digitaler Wandel
2.GewO und Online-Angebote
a) Online-Auktionen
b) Online-Vermittlungsplattformen
3.Online-Dienste und deutsches öffentliches Wirtschaftsrecht
a) Niederlassung in Deutschland
b) Auswirkungsprinzip und Dienste der Informationsgesellschaft
§ 4 Das Gaststättenrecht
I. Gaststättenrecht als Gewerberecht
II. Die Anwendbarkeit des GastG – Der Gaststättenbegriff
1. Gewerbsmäßigkeit und die Ausnahmen
2. Stehendes Gewerbe und Reisegewerbe mit ortsfester Betriebsstätte
3. Allgemeine Zugänglichkeit des Betriebes
4. Betriebstypen
III. Die Erlaubnispflicht
1.Reichweite der Erlaubnispflicht
a) Die Abgrenzung von erlaubnisfreiem und erlaubnispflichtigem Gaststättengewerbe
b) Gaststättenrechtliches Nebengewerbe
c) Vorläufige und vorübergehende Ausübung des Gaststättengewerbes
2. Gaststättengenehmigung als personengebundene Erlaubnis
a) Der Betreiber als grundsätzlich Erlaubnispflichtiger
b) Die Stellvertretung
3. Gaststättenerlaubnis als betriebsartbezogene Genehmigung
4. Der Raumbezug der Gaststättenerlaubnis
IV. Die Versagung einer Gaststättenerlaubnis
1. Der Versagungsgrund der persönlichen Unzuverlässigkeit (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr 1 GastG)
a) Alkoholmissbrauch
b) Der Unsittlichkeit Vorschub leisten
2. Raumbezogene Versagungsgründe
a) Eignung der Räumlichkeiten
b) Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit
c) Das Verhältnis von baurechtlichem und gaststättenrechtlichem Verfahren
V.Nebenbestimmungen zur Erlaubnis
1. Gesetzliche Vorbehalte für Nebenbestimmungen
2. Insbesondere Auflagen
VI.Rücknahme und Widerruf einer Gaststättenerlaubnis (§ 15 GastG)
1. Die gaststättenrechtliche Regelung in § 15 GastG
2. Die Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften
VII. Das Einschreiten gegen das erlaubnisfreie Gaststättengewerbe
VIII. Die Schließung einer Gaststätte
§ 5 Das Handwerksrecht
I. Die Entwicklung der HwO bis zur Reform von 2004
II.Das zulassungspflichtige Handwerk (Anlage A)
1. Die Eintragung in die Handwerksrolle
2.Die sachlichen Voraussetzungen der Eintragung (Eintragungsbedürftigkeit)
a) Stehendes Gewerbe
b) Zulassungspflichtiges Handwerk
c) Wesentliche Tätigkeit
d) Handwerksmäßiger Betrieb
e) Die erfassten Betriebsformen (Haupt-, Neben-, Hilfsbetrieb)
3.Die persönliche Eintragungsfähigkeit
a) Eintragung mit qualifizierter Betriebsleitung
b) Die Eintragung von Altgesellen (§ 7b HwO)
c) Ausnahmebewilligungen (§ 8 HwO)
d) Besonderheiten für EU-Ausländer (§ 9 HwO)
III.Die Überwachung des zulassungspflichtigen Handwerks
1. Die Zuständigkeitsverteilung zwischen Handwerkskammer und Verwaltungsbehörde
2.Die Eintragung
a) Das Verfahren der Eintragung
b) Maßnahmen der höheren Verwaltungsbehörde bei Unterlassen der Anmeldung
3. Löschung aus der Handwerksrolle
4. Betriebsuntersagung
5. Betriebsschließung
6. Die ergänzende Anwendung des Gewerberechts
IV. Zulassungsfreies Handwerk und handwerksähnliche Gewerbe (Anlage B)
§ 6 Grundzüge einer sektorenspezifischen Regulierung
I.Einführung
Читать дальше