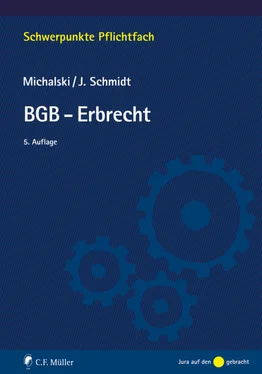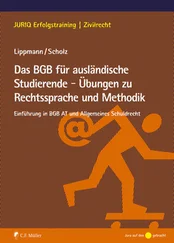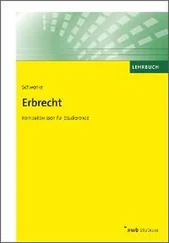c) Zweifel über die Höhe der Erbteile
363
§§ 2088-2093enthalten Auslegungs- und Ergänzungsregeln für Fälle, in denen Zweifel über die Höhe der Erbteile bestehen.
364
Hat der Erblasser nicht über seinen gesamten Nachlass verfügt, so tritt gem. § 2088im Übrigen gesetzliche Erbfolge ein. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Ergänzungsregel, d.h. ein abweichender Wille des Erblassers hat Vorrang.[105] Testamentarische und gesetzliche Erben bilden eine Miterbengemeinschaft (§ 2032 Abs. 1).
365
Sollen die eingesetzten Personen nach dem Willen des Erblassers die alleinigen Erben sein, so werden die Bruchteile, wenn sie das Ganze nicht erschöpfen, verhältnismäßig erhöht ( § 2089) bzw., wenn sie das Ganze übersteigen, verhältnismäßig gemindert ( § 2090).
366
Wenn zwar klar ist, wer Erbe werden sollen, aber die Höhe der jeweiligen Erbteile unbestimmt ist, so erben die eingesetzten Personen zu gleichen Teilen ( § 2091) bzw. den freigebliebenen Teil zu gleichen Teilen ( § 2092 Abs. 1). Wie schon der Verweis auf die §§ 2066 ff. zeigt, ist jedoch zuvor durch Auslegung zu ermitteln, ob nicht die Erben auf verschieden große Bruchteile eingesetzt sind.[106]
367
Der Erblasser kann mehrere Erben auch auf einen gemeinschaftlichen Erbteileinsetzen (§ 2093). Ob dies der Fall ist, ist durch Auslegung zu ermitteln.[107] Maßgeblich ist insoweit insb., ob zwischen den als gemeinschaftlichen Erben zusammengefassten Personen eine persönliche oder sachliche Beziehung besteht.[108] Die bloße Bezeichnung „die Eheleute X“ ist für sich allein noch kein ausreichendes Indiz für die Einsetzung auf einen gemeinschaftlichen Erbteil.[109] In Ansehung des gemeinschaftlichen Erbteils finden gem. § 2093 die §§ 2089–2092 entsprechende Anwendung.
368
Hat der Erblasser durch Einsetzung mehrerer Erben die gesetzliche Erbfolge völlig ausgeschlossen, entspricht es i.d.R. nicht seinem Willen, beim Wegfall eines der Erben im Übrigen gesetzliche Erbfolge eintreten zu lassen. § 2094übernimmt daher mit der Anwachsungdas Prinzip der Erbteilserhöhung (§ 1935) aus dem gesetzlichen Erbrecht. Dazu näher → Rn. 731 ff.
e) Auslegungsregeln für Bedingungen
369
Ebenso wie prinzipiell jedes Rechtsgeschäft können auch letztwillige Verfügungen unter eine aufschiebende oder auflösende Bedingunggestellt werden; dies wird im BGB zwar nicht explizit geregelt, aber in den §§ 2074 ff. vorausgesetzt. Diese Vorschriften enthalten eine Reihe von Auslegungsregeln für die Wirkungen solcher Bedingungen.
370
Hat der Erblasser eine letztwillige Zuwendung unter einer aufschiebenden Bedingunggemacht, so ist gem. § 2074im Zweifel anzunehmen, dass die Zuwendung nur gelten soll, wenn der Bedachte den Bedingungseintritt erlebt. Die echte Bedingung ist dabei vom bloßen Anlass der Testamentserrichtung, von unverbindlichen Wünschen und von der Auflage gem. § 1940 (→ Rn. 937 ff.) abzugrenzen. Eine echte Bedingung liegt nur dann vor, wenn der Wille des Erblasser erkennbar darauf gerichtet ist, die Wirksamkeit der Verfügung an den Eintritt eines für ungewiss gehaltenen Umstands zu knüpfen.[110] Für eine Befristung gilt nicht § 2074, sondern § 163.[111]
Beispiele:
Die Formulierung „Dies Testament gilt nur bei einem Unfall oder sollte ich nicht aus Russland wiederkommen“ stellt eine echte Bedingung dar.[112] Wenn in Form eines Konditionalsatzes auf die Umstände der Testamentserrichtung Bezug genommen wird („sollte mir bei der Gallenoperation etwas zustoßen“), so stellt dies regelmäßig nur einen Hinweis auf den Anlass (Motiv) der Testamentserrichtung dar.[113]
371
Wird eine Zuwendung unter der Bedingung eines Tuns oder Unterlassens des Bedachten von unbegrenzter Dauer gemacht, so käme der Bedachte nie in den Genuss der Zuwendung, wenn man eine aufschiebende Bedingung annehmen würde; denn dann stünde erst im Zeitpunkt seines eigenen Todes fest, dass die Bedingung erfüllt ist. § 2075stellt deshalb die Auslegungsregel auf, dass eine solche Bedingung als auflösende Bedingungzu verstehen ist.[114]
Beispiel:
Eine als „Vereinbarung“ überschriebene Erbeinsetzung bei gleichzeitiger Übernahme einer Pflegeverpflichtung ist, wenn es an einem festen Bindungswillen des Erblassers fehlt, als auflösend bedingte Erbeinsetzung und nicht als Erbvertrag auszulegen.[115]
372
Ist der Eintritt einer Bedingung von der Mitwirkung des Bedachten abhängig, so gilt auch für letztwillige Verfügungen § 162.[116] Diese allgemeine Vorschrift wird durch die Auslegungsregel des § 2076ergänzt, die den Eintritt einer aufschiebenden Bedingung zum Vorteil eines Drittenfingiert, wenn dieser die zum Eintritt der Bedingung erforderliche Mitwirkungshandlung unterlässt.
373
§ 2077betrifft den Fall, dass der Erblasser seinen Ehegatten[117] oder Verlobten bedacht hat und die Ehebzw. das Verlöbnisvor dem Tod des Erblassers aufgelöstwird. In diesem Fall ist die letztwillige Verfügung zugunsten des Ehegatten (Abs. 1) bzw. Verlobten (Abs. 2) unwirksam, sofern nicht anzunehmen ist, dass der Erblasser sie auch für diesen Fall getroffen haben würde (Abs. 3). Das Bestehenbleiben der Ehe bzw. des Verlöbnisses wird also quasi zur auflösenden Bedingung der Verfügung gemacht. Zu § 2077 auch noch → Rn. 391.
III. Die Auslegung von Erbverträgen und gemeinschaftlichen Testamenten
374
Bei der Auslegung von Erbverträgen ist zwischen vertragsmäßigen (→ Rn. 272) und einseitigen (→ Rn. 273) Verfügungen zu differenzieren.
375
Für die Auslegung vertragsmäßiger Verfügungengelten die allgemeinen Regeln über die Auslegung von Verträgen; maßgeblich ist der erklärte übereinstimmende Wille der Vertragsparteien (§§ 133, 157).[118] Selbst bei einseitigen Erbverträgen kommt es aufgrund des Vertragscharakters nicht allein auf den Willen des Erblassers an, sondern auf den objektiven Empfängerhorizont.[119] Gem. § 2279 Abs. 1 gelten jedoch auch die gesetzlichen Auslegungsregeln für Testamente entsprechend. § 2280 ergänzt zudem eine spezielle Auslegungsregel für Erbverträge, in denen sich Ehegatten oder Lebenspartner gegenseitig als Erben einsetzen; hier gilt § 2269 (→ Rn. 238) entsprechend.
376
Für einseitige Verfügungengelten hingegen ausschließlich die Grundsätze und Regeln für die Auslegung von Testamenten, inkl. der gesetzlichen Auslegungsregeln (vgl. § 2299 Abs. 2 S. 1).[120]
2. Gemeinschaftliche Testamente
377
Ähnlich ist bei der Auslegung gemeinschaftlicher Testamente zwischen wechselbezüglichen (→ Rn. 239 ff.) und nicht wechselbezüglichen Verfügungen zu differenzieren.
378
Wechselbezügliche Verfügungenhaben zwar keinen Vertragscharakter, aber aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit und der Bindungswirkung nach dem Tod des ersten Ehegatten ist die Interessenlage hier derjenigen beim Erbvertrag vergleichbar; daher gelten insoweit die Regeln für die Auslegung von vertragsmäßigen Verfügungen in Erbverträgen (→ Rn. 375) entsprechend.[121]
379
Für nicht wechselbezügliche Verfügungengelten hingegen die gleichen Rechtsgrundsätze und gesetzlichen Auslegungsregeln wie für Einzeltestamente.[122]
Читать дальше