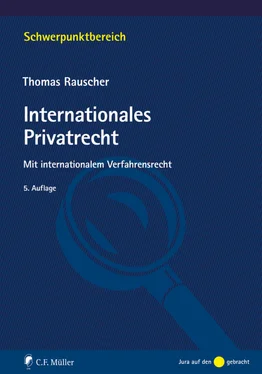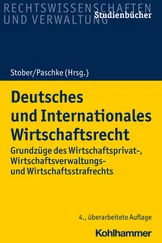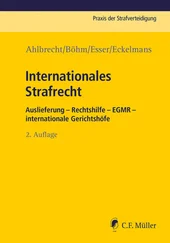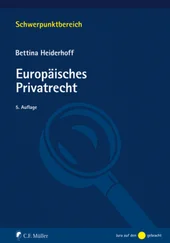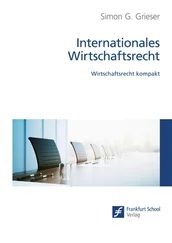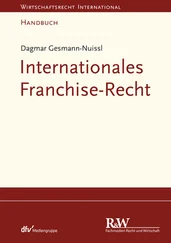4
3.Art. 3 setzt für die Anwendung des deutschen IPR eine „Verbindung zu einem ausländischen Staat“ (Auslandsbezug)voraus. Die Feststellung eines solchen Auslandsbezugs ist aber nicht technisch-tatbestandliche Voraussetzung für die Anwendung von Normen des IPR, er hat gegenüber den Anknüpfungskriterien, die in den Kollisionsnormen, zB Art. 7 ff, die Verbindung zum anwendbaren Recht beschreiben, keine eigenständige Filterfunktion. Erst die Anwendung der Normen des IPR zeigt, ob in dem Fall auf bestimmte Sachfragen ein ausländisches Recht angewendet wird. Theoretisch lässt sich das deutsche IPR daher auf jeden im Inland zu entscheidenden Sachverhalt anwenden und führt in „reinen Inlandsfällen“ zwangsläufig zur Anwendung deutschen Rechts. Kein vernünftiger Rechtsanwender wird nun aber jeden Inlandsfall mit einer schematischen, offensichtlich überflüssigen IPR-Prüfung beginnen. Ob man – in Klausur oder Praxis – das IPR tatsächlich prüft, hängt daher nicht von einem als Tatbestandsmerkmal definierten, sondern einem nur mit einiger Erfahrung intuitiv festgestellten Auslandsbezug ab. Ein solcher Auslandsbezug besteht dann, wenn der Sachverhalt irgendwelche möglicherweise für das IPR relevante Elemente enthält, die auf einen ausländischen Staat hinweisen (Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Aufenthalt eines Beteiligten, Belegenheit betroffenen Vermögens, Währung bei Schuldverträgen, Vertragsschluss-, Handlungs- oder sonstige Ereignisorte); liegt auch nur ein solches Element vor, wird man sinnvoller Weise das IPR prüfen, um eine unzutreffende Fallbehandlung durch Übergehen des IPR zu vermeiden. Die richtige Anwendung des IPR auf einen „reinen Inlandsfall“ kann jedenfalls nicht zu einer falschen Falllösung führen.
Verpachtet eine in Delaware (USA) gegründete Gesellschaft eine in Hamburg belegene Gaststätte an einen Deutschen, so besteht jedenfalls hinsichtlich der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft ein Auslandsbezug, auch wenn die kollisionsrechtliche Prüfung des Vertragsstatuts zu deutschem Pachtrecht führen kann.
5
4.Diese Prüfung des IPR nimmt das Gericht, sobald ein Auslandsbezug in Betracht kommt, von Amts wegenvor. Auf die Anwendung ausländischen Rechts muss sich keine Partei berufen.[2]
6
Die Bedeutungdes IPR hat seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, vor allem aber seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, um ein Vielfaches zugenommen. Diese Entwicklung beruht im Vertrags- und Wirtschaftsrecht einerseits auf der Globalisierung des Wirtschaftsverkehrs, zunehmenden privaten sowie geschäftlichen Reisen und dem Anwachsen von Vertragsschlüssen im Internet, andererseits auch auf einem starken internationalen Vertrauen in die Qualität und Leistungsfähigkeit der deutschen Rechtsprechung, die nicht selten – sofern eine internationale Zuständigkeit besteht – auch von Handelspartnern in Anspruch genommen wird, deren Geschäfte ihren Schwerpunkt nicht im Inland haben. Eine gegenläufige Tendenz ergibt sich freilich in Branchen, deren Vertragsbeziehungen stark durch angelsächsische Rechtsvorstellungen geprägt sind (zB Finanzinstitute) und die deshalb zur Vereinbarung von Gerichtsständen in London oder New York neigen.[3] Im Personen-, Familien- und Erbrecht hat die vor allem in den 1960er und 1970er Jahren ausgelöste Immigration von ausländischen Arbeitnehmern, aber auch die Bedeutung Deutschlands als Zielland von Flüchtlingsbewegungen zu einer starken Vermehrung von Fällen mit Auslandsberührung vor deutschen Gerichten und Behörden geführt.
III. Grundsätzlich nationale Regelung
7
Internationales Privatrechtist Privatrecht , jedoch nicht materielles Privatrecht . Es ist im Grundsatz auch nicht international , sondern nationales Rechtjedes einzelnen Staates – was nicht ausschließt, dass es völkervertraglich, vor allem aber zunehmend europarechtlich vereinheitlichtes IPR gibt. Obgleich Art. 3 auf die Vorschriften des Zweiten Kapitels des EGBGB verweist, findet sich deutsches IPR nicht nur im EGBGB, sondern auch in Spezialgesetzen sowie in Richter- und Gewohnheitsrecht.
8
Über das beschriebene Verständnis des IPR hinaus wird teilweise als „Internationales Privatrecht im weiteren Sinn“ die Gesamtheit aller Normen bezeichnet, die privatrechtliche Sachverhalte mit einem Auslandsbezugregeln. Hierzu gehören neben dem IPR (im engeren Sinn) auch die privatrechtlichen Normen des Fremdenrechts ; dies sind Bestimmungen, welche materiell privatrechtliche Sachverhalte abweichend regeln, sofern an ihnen ein Ausländer beteiligt ist.
Privatrechtliche Normen des Fremdenrechts haben neben den öffentlich-rechtlichen (Aufenthaltsgenehmigung, Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, Arbeitserlaubnis) geringere Verbreitung. Insbesondere gelten in Deutschland keine Beschränkungen gegenüber Ausländern beim Erwerb von Grundstücken (vgl Art. 86); der Schutz von Immaterialgüterrechten ist für Ausländer eingeschränkt (§§ 121 ff UrhG). Wichtige fremdenrechtliche Normen finden sich auch im Zivilverfahrensrecht (§ 110 ZPO: Ausländersicherheit).
Hierzu zählen auch privatrechtliche Vorschriften, deren Tatbestand einen Auslandsbezug enthält, zB § 1944 Abs. 3 BGB (Ausschlagungsfrist bei letztem Wohnsitz des Erblassers im Ausland), § 1954 Abs. 3 BGB (Anfechtungsfrist bei Wohnsitz des Erblassers oder Aufenthalt des Erben im Ausland) oder § 2251 BGB (Seetestament auf deutschem Schiff außerhalb eines inländischen Hafens). Dies können auch Normen international vereinheitlichten Privatrechts sein; so ist zB das Einheitliche UN-Kaufrecht (CISG von 1980) ein auf internationale Sachverhalte, nämlich grenzüberschreitende Kaufverträge, anwendbares Recht. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte man solche Normen nicht als „IPR im weiteren Sinn“, sondern als „Privatrecht für Sachverhalte mit Auslandsbezug“bezeichnen.
Teil I IPR: Grundlagen› § 1 Einführung und Abgrenzung› B. IPR und andere Rechtskollisionen
B. IPR und andere Rechtskollisionen
I. Interlokale Rechtsspaltung
9
In zahlreichen Staaten gilt kein einheitliches (kodifiziertes oder unkodifiziertes) Privatrecht. Von interlokaler Rechtsspaltungoder interlokalen Mehrrechtsstaaten spricht man, wenn in geographisch unterschiedlichen Gebieten eines Staates verschiedenes Privatrecht gilt. In solchen Staaten existieren im geschriebenen Recht, im Richterrecht oder im Gewohnheitsrecht Kollisionsregeln, welche über die Zuordnung eines Sachverhaltes zu einer jeweiligen Teilrechtsordnung entscheiden. Die Gesamtheit dieser Normen ist das Interlokale Privatrechtdes jeweiligen Mehrrechtsstaates.
2. Entstehung von Mehrrechtsstaaten
10
Ursache für die Entstehung solcher Staaten waren auf dem europäischen Kontinent in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem Grenzverschiebungenund Ausdehnungenvon Staaten, sowie zentralistische Staatenbildungen, die sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts zum Teil durch Dismembration wieder aufgelöst haben.
So galt zB in Teilen Ungarns das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, in anderen Teilen alt-ungarisches Gewohnheitsrecht. Insbesondere die Gebietsverschiebungen im Zuge der Friedensverträge zur Beendigung des Ersten Weltkriegs führten zu einer starken Regionalisierung des geltenden Rechts auf dem Balkan.
Читать дальше