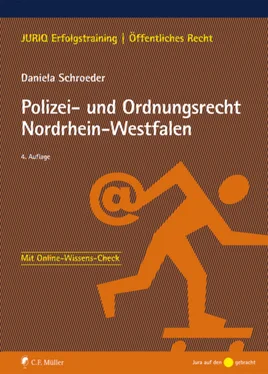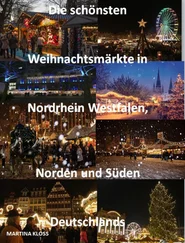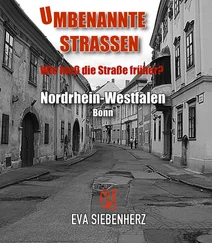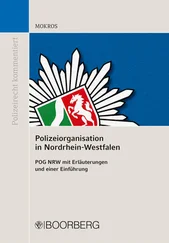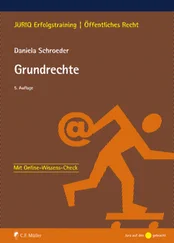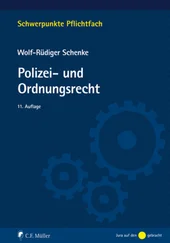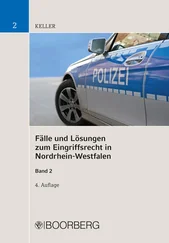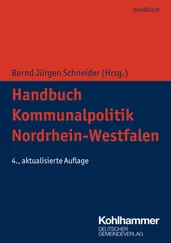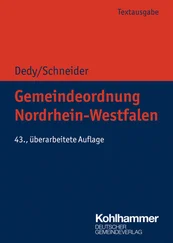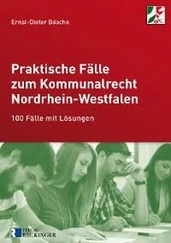Die Konsequenz heißt „verteiltes statt massiertes Lernen“, den Lernstoff also mit Zwischenpausen bearbeiten.
| • |
Zuerst langsam und aufmerksam lesen und nicht direkt einprägen wollen. |
| • |
Pause: Etwas ganz anderes tun. |
| • |
Wesentliche einzelne Begriffe und Zusammenhänge aufschreiben. |
| • |
Pause: Wieder ganz andere Dinge tun, auch Geistiges, jedoch möglichst unähnlich zu dem bisherigen Lernstoff. |
| • |
Wieder Begriffe und Zusammenhänge einprägen. |
| • |
usw. |
Für Definitionen und Aufbauschemata zu einem Thema sind Abstände von 20 bis 40 Minuten zu empfehlen, bei größeren Textabschnitten wie Buchkapiteln können das auch mehrere Stunden sein.
Den Lernmotor und Ihre Motivation vor Überbelastung schützen!
Die maximale Leistungsfähigkeit kann nur in einem begrenzten Zeitraum erreicht werden. Bei Überschreitung passieren Fehler, die Leistung wird gemindert und die Motivation möglicherweise dauerhafter geschädigt. Vor Eintritt in eine solche Negativphase sollten Sie ein für Sie passendes Pausenmanagement einrichten.
Generell gilt:
| • |
Häufige Pausen von weniger als 20 Minuten sind besonders effektiv und besser als wenige lange Pausen. |
| • |
Pausen sollten nicht mit lernnahen Tätigkeiten oder speicherbelastenden Aktivitäten (PC-Spiele) ausgefüllt werden. |
Beispiele für unterschiedliche Pausenarten, die in den Tages- und Lernablauf integriert werden sollten:
| • |
Abspeicherpausen (Augen zu): 10 bis 20 Sekunden nach Definitionen, Begriffen und komplexen Lerninhalten zum sicheren Abspeichern und zur Konzentration. |
| • |
Umschaltpausen: 3 bis 5 Minuten nach ca. 20 bis 40 Minuten Arbeit, um Abstand zum vorher Gelernten zu bekommen und dadurch besser Neues aufzunehmen. |
| • |
Zwischenpausen: 15 bis 20 Minuten nach 90 Minuten intensiver Arbeit, also nach zwei Arbeitsphasen, dient dem Erholen und Abschalten. |
Und nicht vergessen:
| • |
Die lange Erholungspause von 1 bis 3 Stunden, z. B. mittags oder zum Feierabend nach 3 Stunden Arbeit sollten Sie ebenfalls zum richtigen Abschalten, Regenerieren, Sich-Belohnen nutzen! |
Die Lernarbeit positiv abschließen!
Unsere Erinnerung behält vor allem die letzten Erlebnisse. Endet ein an und für sich schöner Abend mit einem Streit, so wird der Abend rückwirkend als unangenehm empfunden. Ein Kellner bietet uns nach dem Essen auf Rechnung des Hauses einen Espresso oder Schnaps an. Wenn wir uns erinnern, werden wir geneigt sein, das gute Essen noch besser zu erinnern. D. h. wenn eine Tätigkeit positiv beendet wird, wird sie insgesamt als positiver erlebt.
Nach einer längeren Arbeitsphase von 1 bis 3 Stunden können Sie Folgendes tun:
| • |
Bewusst feststellen, was Sie alles geschafft haben, beachten Sie dabei weniger die unbearbeitete Menge. |
| • |
Vergleichen Sie, was Sie zu Beginn einer Lernphase konnten oder wussten – und was Sie nun beherrschen. |
| • |
Legen Sie eventuell ein Karteikartensystem an, mit dem Sie sehr leicht feststellen können, was Sie können (z. B. eine Kartei mit Aufbauschemata, Definitionskartei; siehe dazu auch die Arbeitskarten aus dem ersten Lerntipp) |
Jeden Tag das gleiche Ritual!
Der Abschluss eines Lerntages sollte auch symbolisch eine Zäsur setzen, analog dem Wechsel von Arbeit zu Freizeit mit der Schulklingel oder dem Kleidungswechsel nach der Arbeit.
Abschlussrituale am Ende eines Tages können sein:
| • |
Denken Sie bereits 10 Minuten vor dem Arbeitsende eines Tages an das Ende der Arbeit. |
| • |
Denken Sie kurz aber bewusst darüber nach, an welcher Stelle Sie die Arbeit für heute beenden. |
| • |
Sagen Sie sich bewusst: Für heute ist die Arbeit für mich beendet. |
| • |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geleistete. |
| • |
Machen Sie sich kurze Notizen, welche Aspekte in der nächsten Arbeitsphase zu berücksichtigen sind. Das erleichtert den Einstieg am Folgetag. |
| • |
Klappen Sie den Ordner bewusst zu, fahren Sie den PC bewusst herunter und sagen Sie sich „Ich habe jetzt Freizeit!“ |
| • |
Verlassen Sie den Arbeitsplatz und den Arbeitsbereich. Wenn möglich, ziehen Sie sich um. |
| • |
Gestalten Sie dieses Abschlussritual jeden Tag! |
1
Dieses Skript behandelt das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht Nordrhein-Westfalen. In der ersten Prüfung und im zweiten juristischen Staatsexamen gehört das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht zu den Pflichtfächern (vgl. §§ 11 Abs. 2 Nr. 13 lit. a; 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 JAG NRW[1]) und ist regelmäßig Prüfungsgegenstand.
2
Fallbearbeitungen aus dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht sind in Prüfungen beliebt. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht ist allgemeines Gefahrenabwehrrecht und steht als solches beispielhaft für den klassischen Bereich der Eingriffsverwaltung, der in einer Prüfung ohne Weiteres mit verfassungsrechtlichen Problemstellungen, insbesondere grundrechtlichen Fragen, verbunden werden kann.[2] Als Materie des besonderen Verwaltungsrechts baut das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht außerdem auf dem allgemeinen Verwaltungsrecht auf, so dass regelmäßig auch das allgemeine Verwaltungsrecht relevant ist. Dazu gehören vor allem auch verwaltungsvollstreckungsrechtliche Aspekte. Schließlich wird das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht mit Hilfe des Verwaltungsprozessrechts durchgesetzt. Prüfungen im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht haben daher regelmäßig einen prozessrechtlichen Aufhänger, so dass auch entsprechende verfahrensrechtliche Kenntnisse zur Lösung des Falls abverlangt werden. Vor diesem Hintergrund sollten Sie dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht bei Ihrer Prüfungsvorbereitung daher unbedingt die entsprechende Aufmerksamkeit schenken!
[1]
Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen.
[2]
Vgl. hierzu die beispielhafte Darstellung typischer polizei- und ordnungsrechtlicher Fallgestaltungen bei Kugelmann Polizei- und Ordnungsrecht Kap. 1 Rn. 80 ff.
2. Teil Grundlagen des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts
Inhaltsverzeichnis
A. Gegenstand des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts
B. Unterscheidung zwischen allgemeinem und besonderem Polizei- und Ordnungsrecht
C. Historische Entwicklung des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts
D. Der Begriff der Polizei
E. Gesetzgebungskompetenz für das Polizei- und Ordnungsrecht nach dem Grundgesetz
F. Allgemeine Polizei- und Ordnungsgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen
G. Verwaltungszuständigkeiten im Bereich des Polizei- und Ordnungsrechts
H. Aufbau und Struktur der Polizei- und Ordnungsverwaltung in Nordrhein-Westfalen
I. Verteilung der Aufgaben zwischen der Polizei und der Ordnungsverwaltung
3
In diesem Teil des Skripts werden wir uns zunächst mit einigen Grundlagen befassen, die für das Grundverständnis des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts unerlässlich sind.
2. Teil Grundlagen des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts› A. Gegenstand des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts
A. Gegenstand des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts
Читать дальше