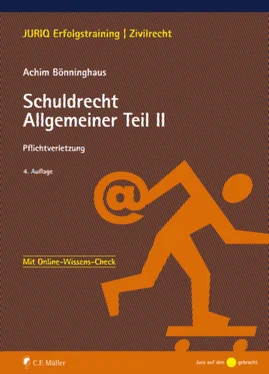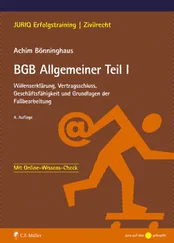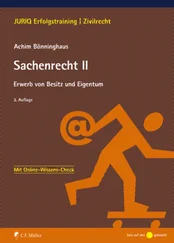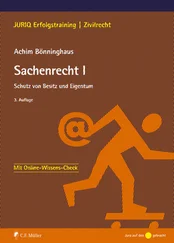Frankfurt, im Januar 2020 Achim Bönninghaus
[1] Zu den Fußnoten: Sie werden feststellen, dass Literaturverzeichnis und Fußnotenapparat „übersichtlich“ gehalten sind, um es noch milde zu formulieren. Das Skript will gar nicht den Anspruch erheben, das Schrifttum auch nur annähernd vollständig zu belegen. Das kann es gar nicht leisten. Betrachten Sie die Literaturangaben eher als persönliche Leseempfehlungen. Das gilt übrigens auch für die zitierte Rechtsprechung.[1] Ich würde mich freuen, wenn Sie die eine oder andere Entscheidung nachlesen. Urteile gehören in vielen Bereichen faktisch zu den Primärquellen unserer Rechtsordnung, so dass Sie sich möglichst frühzeitig an Stil und Aufbereitung des Stoffes im Urteil gewöhnen sollten. Gerade das noch relativ „junge“ Schuldrecht erfährt seit Inkrafttreten der Schuldrechtsreform eine laufende Ausgestaltung und Prägung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung. Nicht selten werden Examensklausuren neuen Entscheidungen nachgebildet, so dass ich auch unter diesem Aspekt nur dringend raten kann, die Rechtsprechungsentwicklung genau zu verfolgen. Zur Erleichterung haben wir uns bemüht, die „Hausnummer“ der Fundstelle innerhalb der Entscheidung anzugeben. Auf gehtʼs – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs! Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: kundenservice@cfmueller.de . Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Frankfurt, im Januar 2020 Achim Bönninghaus
Die in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kostenlos auf der Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de(Rubrik: „Entscheidungen“) abrufen.
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müller
mit Online-Wissens-Check

Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
| • |
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts. |
| • |
Eine individuelle Lernfortschrittskontrollezeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse. |
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?

Online-Wissens-Check
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Ihr persönlicher User-Code: 960406932
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monatenzur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: info@juriq.de.
zurück zu Rn. 82 Bei Individualvereinbarungen könnte man die Lösung in § 139 suchen, der bei Teilnichtigkeit im Zweifel für die Unwirksamkeit des gesamten Rechtsgeschäfts entscheidet. Dann würde man aber den Schuldner über Gebühr begünstigen, dem die Haftungsbegrenzung zugutekommen sollte. Schließlich bestünden gegen ihn dann mangels vertraglichen Schuldverhältnisses gar keine vertraglichen Primär- und Sekundäransprüche mehr. Das wird allgemein für unbillig gehalten, so dass ein Verstoß gegen ein gesetzliches Vereinbarungsverbot keine Gesamtnichtigkeit des Vertrages nach § 139 auslöst, sondern lediglich zur Unwirksamkeit des Haftungsausschlusses führt, soweit der Verbotstatbestand verletzt ist. [20] Hinweis Der Gesetzgeber berücksichtigt diesen Ansatz in neueren Regelungen, indem er z.B. im (reformierten) § 444 formuliert, der Verkäufer könne sich auf den Haftungsausschluss „nicht berufen“.[21] Online-Wissens-Check Gibt es im Rahmen der Vertragsanbahnung auch schon Erfüllungsgehilfen i.S.d. § 278? Überprüfen Sie jetzt online Ihr Wissen zu den in diesem Abschnitt erarbeiteten Themen. Unter www.juracademy.de/skripte/login steht Ihnen ein Online-Wissens-Check speziell zu diesem Skript zur Verfügung, den Sie kostenlos nutzen können. Den Zugangscode hierzu finden Sie auf der Codeseite .
, 462
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. Teil Einführung
A. Pflichten im Schuldverhältnis
B. Arten der Pflichtverletzung
I. Verletzung von Leistungspflichten
1. Leistungsverzögerung
2. Schlechtleistung
3. Nichtleistung wegen Leistungsbefreiung nach § 275
II. Verletzung von Rücksichtspflichten
C. Aufgaben der Regelungen über Leistungsstörungen
2. Teil Vertretenmüssen
A. Unterscheidung zwischen Vertretenmüssen und Verschulden
B. Vertretenmüssen ohne Verschulden
I.Gesetzliche Bestimmung
1. Gesetzliche Ersatzpflichten ohne Vertretenmüssen im Tatbestand
2. Zufallshaftung nach § 287 S. 2
II. Geldmangel
III. Vertragliche Übernahme
IV. „Sonstiger Inhalt des Schuldverhältnisses“
1. Garantieübernahme
2. Übernahme eines Beschaffungsrisikos
C. Vertretenmüssen wegen Verschuldens des Schuldners
I. Vorsatz
II. Fahrlässigkeit
1. Maßstab
2. Korrektur bei bestimmten Personengruppen
III.Eigenes Verschulden bei „unnatürlichen“ Schuldnern
1. Verschulden eines Repräsentanten
2. Bezug zur Stellung als Repräsentant
D. Vertretenmüssen wegen Verschuldens Dritter (§ 278)
I. Bestehendes Schuldverhältnis
II. Verschulden
III. Erfüllungsgehilfe
1. Tätigwerden mit Willen des Schuldners
2.Tätigwerden bei Erfüllung einer Verbindlichkeit des Schuldners
a) Verbindlichkeit des Schuldners
b) Handeln bei Erfüllung
IV. Gesetzliche Vertreter
E. Erleichterungen im Haftungsmaßstab
I. Gesetzliche Beschränkungen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
II. Haftungsbeschränkung auf die eigenübliche Sorgfalt
III. Vertragliche Haftungsmilderungen
1.Wirksamkeitsvoraussetzungen
a) Allgemeine Wirksamkeitserfordernisse
b) Wirksamkeitshindernisse
2. Besonderheiten bei Haftungsbeschränkung in AGB
3. Auswirkungen unzulässiger Haftungsklauseln
3. Teil Leistungsverzögerung
A. Tatbestand der Leistungsverzögerung
I. Unterscheidung zwischen Leistungsverzögerung und Verzug
II. Nichtleistung trotz Fälligkeit
Читать дальше