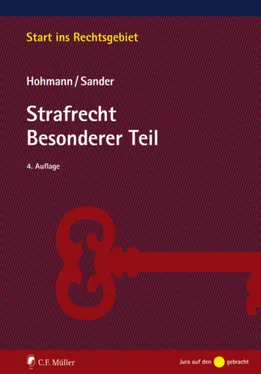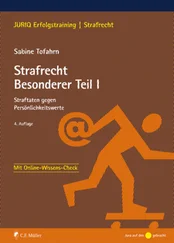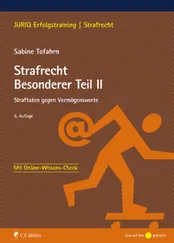1 ...7 8 9 11 12 13 ...45 7
Die Merkmale der Mordlust und der Habgier sind nach zutreffender h.M. – trotz ihrer objektiven Bestandteile – ebenfalls dem subjektiven Tatbestand zuzuordnen. Denn eine Gesamtabwägung ergibt, dass sie überwiegend subjektiv geprägt sind. Dafür spricht zunächst ihre auf persönliche Interessen des Täters abstellende Fassung ( Lust, Gier). Aber auch ihre Gleichstellung mit den übrigen Modalitäten der 1. Gruppe (vgl. Rn. 3) lässt darauf schließen.
| Grundstruktur des Mordtatbestands (h.M.) |
| Objektiver Tatbestand |
Subjektiver Tatbestand |
| – Tatobjekt ( § 1 Rn. 5 ff.) – Tathandlung ( § 1 Rn. 10 f.) – Objektive Mordmerkmale ( Rn. 5und 8 ff.) |
– Vorsatz bzgl. Tötung und objektiver Mordmerkmale ( Rn. 52 ff.) – Subjektive Mordmerkmale ( Rn. 6 f.und 55 ff.) |
Aufbau- und Vertiefungshinweis:
Verschiedentlich werden Merkmale des § 211 Abs. 2 dogmatisch auf der Schuldebene angesiedelt.[5] Die dafür angeführten Gesichtspunkte sind zwar durchaus bedenkenswert. Bei der Bearbeitung einer Prüfungsaufgabe empfiehlt es sich aber, im Einklang mit der h. A. den auch sonst verwendeten Aufbau zu wählen, um eigene Irritationen (und nicht zuletzt auch solche der Prüfer) zu vermeiden.
8
Über das Erfordernis der Tötung eines (anderen) Menschen (vgl. § 1 Rn. 5 ff.) hinaus enthält § 211 Abs. 2 drei objektive Mordmerkmale.
9
Das Festlegen der Voraussetzungen dieses – in Ausbildung und Praxis sehr relevanten – Mordmerkmals steht im Mittelpunkt erheblicher Bemühungen von Rechtsprechung und Wissenschaft. Ein Konsens besteht gleichwohl noch immer nur hinsichtlich des zu wählenden Ausgangspunkts, von dem aus dann diverse Vorschläge entwickelt werden (vgl. Rn. 20 ff.).
Merke:
Heimtücke erfordert jedenfalls, dass der Täter die Arg- und darauf beruhende Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt (vgl. zur subjektiven Komponente des bewussten Ausnutzens Rn. 53 f.).[6]
10
Gegenüber einem Totschlag (§ 212) ist der Unrechtsgehalt somit erhöht, weil der Täter sein Opfer in einer hilflosen Lage überrascht und dadurch daran hindert, dem Anschlag auf sein Leben – zumindest diesen erschwerend – zu begegnen.[7]
11
Merke:
Ein Opfer ist arglos, wenn es sich in der unmittelbaren Tatsituation eines vorsätzlichen tätlichen Angriffs des Täters auf sein Leben oder (wenigstens) seine körperliche Unversehrtheit nicht versieht.[8]
Es ist nicht erforderlich, dass der Täter diese argfreie Situation selbst herbeigeführt oder gefördert hat. Es reicht aus, wenn er eine vorgefundene Lage für sein Vorhaben ausnutzt.[9]
12
(1)Arglosigkeit i.d.S. setzt nach h.M. allerdings voraus, dass das Opfer überhaupt die Fähigkeit zum Argwohn besitzt. Das ist für Kleinstkinder– bei normaler Entwicklung aber nicht mehr für wenigstens drei Jahre alte Kinder –[10] zu verneinen, solange sie nicht in der Lage sind, einem anderen Menschen Vertrauen entgegenzubringen, also konstitutionell ohne Arg sind.[11] Jedoch ist dann ggf. die Arglosigkeit einer Schutzpersonin Betracht zu ziehen,[12] allerdings nur dann, wenn diese den Schutz infolge einer gewissen räumlichen Nähe wirksam hätte erbringen können.[13]
13
Schlafendesind zwar ebenfalls nicht fähig, eine Situation in Bezug auf ihre eventuelle Bedrohlichkeit zu beurteilen und ggf. argwöhnisch zu sein. Es ist jedoch anerkannt, dass sie ihre Arglosigkeit gewissermaßen „mit in den Schlaf nehmen“, so dass ihre heimtückische Tötung möglich ist.[14]
14
Anders soll es nach h.A. regelmäßig bei – auch alkoholbedingter – Bewusstlosigkeitsein, weil diese im Unterschied zum Schlaf nicht abgewendet werden kann.[15] Das vermag nicht zu überzeugen, weil eine trennscharfe Unterscheidung zum „arglos Einschlafenden“ nicht möglich ist. Auch dieser kann vom Schlaf gewissermaßen „überwältigt“ werden. Zudem ist der geringere Schutz des – ob mit oder ohne Arg – bewusstlos werdenden Menschen trotz vergleichbarer Gefährlichkeit seiner Lage nicht einsichtig.[16] Dasselbe gilt im Ergebnis für einen in ein sog. Langzeitkoma gefallenen Menschen.[17]
15
(2)An der Arglosigkeit fehlt es aufgrund der konkreten Tatsituation, wenn der Täter seinem Opfer vor dem Angriff „ in offen feindseliger Haltung“ gegenübertritt.
Beispiele:
A fordert B in aggressivem Ton auf, nach draußen zu kommen, „um die Sache zu klären“.[18]
C droht D unter Vorhalt einer Pistole an, es werde „etwas Böses“ geschehen.[19]
E sticht auf F ein, nachdem dieser beobachtet hat, wie E unmittelbar zuvor den in direkter Nähe stehenden G in gleicher Weise attackiert hat.[20]
16
Anders liegt es, wenn das Opfer die drohende Gefahr gleichwohl erst im letzten Augenblickerkennt[21] und ihm deshalb keine Möglichkeit mehr bleibt, dem Angriff zu begegnen.[22] Eine bloß verbale Attacke des Täters lässt die Arglosigkeit des Opfers regelmäßig ebensowenig entfallen[23] wie eine generell feindselige, zu einer lediglich latenten Angst führende Atmosphäre[24] oder ein beispielsweise berufsbedingt – etwa bei einem Polizisten – bestehendes allgemeines Misstrauen.[25] Anders kann es sein, wenn es bereits in der Vergangenheit zu massiven Tätlichkeiten und ernsthaften Todesdrohungen gekommen ist (vgl. aber Rn. 17 f.).[26] Auch wird ein Erpresser regelmäßig nicht arglos sein, wenn er seine Tat in direkter Konfrontation mit seinem Opfer zu vollenden versucht und deshalb mit einer Verteidigung gegen seinen rechtswidrigen Angriff rechnen muss.[27]
17
Arglos kann ein Mensch schließlich auch (wieder) sein, wenn ein Angriff oder eine Drohung ihn zwar Übles seitens des Täters hatte befürchten lassen, dieses Szenario aber tatsächlich oder zumindest nach Ansicht des Opfers beendet ist.[28]
Beispiel:
A erdrosselt den von dem Angriff überraschten B. Zwar hatte A ihm die Tötung einen Monat zuvor angedroht, danach hatten beide jedoch wieder einen „normalen Umgang“ miteinander gepflegt.[29]
Beachte:
Bei der Prüfung der Arglosigkeit ist in der Regel auf den Zeitpunkt des Beginns des ersten mit Tötungsvorsatz geführten Angriffsabzustellen. Es kommt also darauf an, ob das Opfer bei Eintritt der Tat in das Versuchsstadium (noch) arglos ist.[30]
18
Eine Ausnahmewird insoweit zugelassen, wenn der Täter das Opfer nach einem wohlüberlegten Plan mit Tötungsvorsatz in einen Hinterhaltlockt, ihm eine raffinierte Falle stellt oder ihm verborgen auflauert.[31] Tritt er dem bis dahin arglosen Opfer nun in offen feindlicher Haltung entgegen, vermag dies an der listigen Ausnutzung der (ursprünglichen) Arglosigkeit nichts mehr zu ändern,[32] und zwar selbst dann nicht mehr, wenn das Opfer tatplangemäß zunächst noch ausgeraubt wird.[33] Ebenso verhält es sich, wenn bei einem zunächst allein auf eine Körperverletzung zielenden Angriff ein Wechsel zum Tötungsvorsatz derart schnell erfolgt, dass der Überraschungseffektbis zu diesem Moment anhält.[34]
19
Wehrlos ist, wer zu seiner Verteidigung überhaupt nicht imstande oder mindestens in seiner Abwehrbereitschaft und -fähigkeit stark eingeschränkt ist.[35] Da es auf den Augenblick desAngriffsbeginns ankommt (vgl. Rn. 17), ist es für die Frage der Wehrlosigkeit ohne Bedeutung, wenn es dem Opfer im Verlauf eines Kampfgeschehens gelingt, doch noch Abwehrmaßnahmen zu entfalten[36] und ob diese erfolgreich sind.[37] Hingegen ist ein Mensch nicht wehrlos, wenn er von vornherein mit Aussicht auf Erfolg Verteidigungsmittel (z.B. Faustschläge)[38] einsetzen, Hilfe herbeirufen oder auch zu fliehen versuchen kann.[39]
Читать дальше