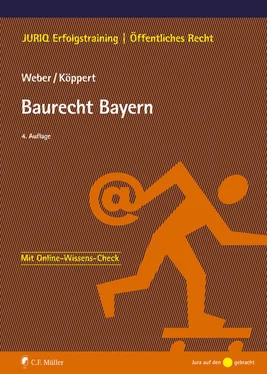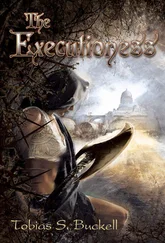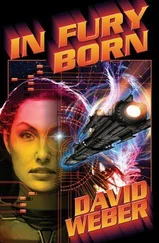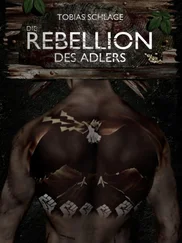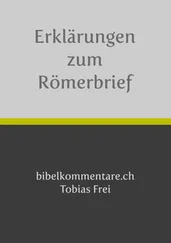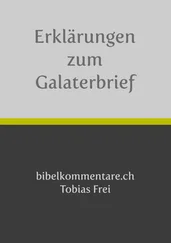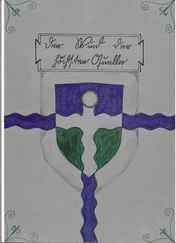Nun legen Sie eine Pause von einer knappen Minute mit einer Kurzentspannung mit geschlossenen Augen ohne Ruhebild ein und betrachten die anstehenden Aufgaben. Jetzt ist der Auftrag (Suggestion) erteilt und Sie können zügig mit der Weiterarbeit beginnen.
Überlegen Sie sich Ihre Autosuggestionen oder „Selbstbeauftragungen“ vor der Entspannung. Es kann z.B. auch motivationsförderliches Selbstlob sein („Ich habe schon etwas länger arbeiten können, Pausen besser eingehalten, folgende Dinge erledigt . . .“) oder andere lernförderliche Übungen und Selbstverbalisierungen.
Diese Lerntipps helfen und haben ihre Grenzen!
Autohypnose hilft nur, wenn sie regelmäßig und konsequent, also in der Übungsphase auch mehrmals täglich angewendet wird. Wenn Sie sehr viele Tagträume haben, die eher in Richtung Angstphantasien, Schwarzmalereien oder Realitätsflucht gehen, sollten Sie vorsichtiger mit der Anwendung sein. Sie können natürlich auch einen Experten wie einen Coach zu Rate ziehen. Bei sehr starken Lern- und Leistungsstörungen oder Depressionen, Ängsten, Lebenskrisen sollten Sie einen Psychotherapeuten oder eine Beratungsstelle konsultieren. Unsere Übungen können kein Ersatz dafür sein, sind aber eine hervorragende Grundlage zur direkten Entspannung, aber auch um seine mentalen Techniken an anderer Stelle weiterzuentwickeln (durch Bücher, in Übungsgruppen).
1. Teil Grundlagen und Grundbegriffe
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung
B. Verfassungsrechtliche Vorgaben für das öffentliche Baurecht
1. Teil Grundlagen und Grundbegriffe› A. Einleitung
1
Bauliche Tätigkeit stellt eine Grundtätigkeit des Menschen dar, die vielfältige Auswirkungen auf die Allgemeinheit und die natürliche Umgebung hat.
Mit diesen Auswirkungen beschäftigt sich das Baurecht.
Dem Begriff des Baurechts unterfallen dabei sowohl das öffentliche wie das private Baurecht.
Ein Hinweis vorweg: Erarbeiten Sie sich das Baurecht anhand der gesetzlichen Bestimmungen. Das Gesetz sollte bei Lektüre dieses Skriptums Ihr ständiger Begleiter sein.
1. Teil Grundlagen und Grundbegriffe› A. Einleitung› I. Das private Baurecht
2
Das private Baurecht beurteilt sich überwiegend nach den Vorschriften des BGB. Dabei sind insbesondere sachenrechtliche Bestimmungen von Bedeutung. Daneben können aber auch Bestimmungen aus dem Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGB) sowie das Deliktsrecht (§§ 823 ff. BGB)[1] relevant werden.
1. Teil Grundlagen und Grundbegriffe› A. Einleitung› II. Das öffentliche Baurecht
II. Das öffentliche Baurecht
3
Das öffentliche Baurecht versucht die Bautätigkeit in geordnete Bahnen zu lenken, indem es die Belange normiert, auf die beim Bauen Rücksicht zu nehmen ist. So wird beispielsweise in den §§ 30 ff. BauGB die Bautätigkeit auf bestimmte Bereiche konzentriert, um dergestalt eine völlig ungeordnete Bautätigkeit zu verhindern. Daneben bestimmt das öffentliche Baurecht aber auch, wie das einzelne zu errichtende Gebäude beschaffen sein muss und wie viel Meter Abstand es beispielsweise zum Gebäude auf dem Nachbargrundstück einhalten muss.
Das öffentliche Baurecht umfasst demnach die Summe der Rechtsregeln, die sich auf Zulässigkeit, Ordnung, Grenzen und Förderung der Errichtung baulicher Anlagen und auf deren bestimmungsgemäße Benutzung beziehen.[2] Dabei ist nun der Verteilung den Gesetzgebungskompetenzen im Grundgesetz (GG) folgend weiter zwischen Bauplanungsrechtund Bauordnungsrechtzu unterscheiden. In diese beiden Rechtsmaterien ist das öffentliche Baurecht zu unterteilen.
4
Das Bauplanungsrecht (Städtebaurecht) ist gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG eine Materie der konkurrierenden Gesetzgebung. Von dieser hat der Bund mit dem Erlass des Baugesetzbuches (BauGB) Gebrauch gemacht.
Kennzeichen des BauGB ist dessen Flächenbezogenheit. Das Bauplanungsrecht sieht das einzelne Bauvorhaben im größeren städtebaulichen Zusammenhang. Es regelt, wie die städtebauliche Ordnung beschaffen sein soll, wie diese erreicht und bewahrt werden kann und wie sich das einzelne Vorhaben darin einzufügen hat.[3]
Maßgebliche Gegenstände des Bauplanungsrechts sind das Recht der Bauleitplanung( §§ 1–13b BauGB), die Sicherung der Bauleitplanung(§§ 14–28 BauGB) und die Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung(§§ 29–38 BauGB).
5
Daneben ermächtigt das BauGB in § 9a das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Rechtsverordnungenzu erlassen. Auf dieser Grundlage ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO)erlassen, die maßgebliche Bestimmungen über Darstellungen und Festsetzungen in den Bauleitplänen enthält (§ 9a Nr. 1 BauGB).
JURIQ-Klausurtipp
Prägen Sie sich an dieser Stelle bereits ein, dass BauGB und BauNVO die maßgeblichen Normkomplexe für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens darstellen. Kommentieren Sie sich neben § 9a Nr. 1 BauGB die BauNVO als auf dieser Ermächtigungsgrundlage erlassene Rechtsverordnung.
6
Das Bauordnungsrecht wird nicht von Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG erfasst, sondern fällt nach Art. 30, 70 GG in die Zuständigkeit der Länder. In Bayern ist das Bauordnungsrecht überwiegend in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt.
Anders als das flächenbezogene Bauplanungsrecht ist das Bauordnungsrecht objektbezogenund betrifft die einzelne bauliche Anlage.
Das Bauordnungsrecht regelt zum einen materiell-rechtliche Anforderungen an bauliche Anlagen und Bauprodukte (Art. 1 Abs. 1 S. 1 BayBO) sowie an Grundstücke und andere Anlagen und Einrichtungen (Art. 1 Abs. 1 S. 2 BayBO). Zum Bauordnungsrecht gehören aber auch die die Bautätigkeit betreffenden Verfahrensvorschriften. Geregelt sind u.a. die Anforderungen an das Genehmigungsverfahren und die Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden.
Das materiell-rechtliche Bauordnungsrecht mit seinen Anforderungen an die einzelne bauliche Anlage stellt dabei eine Rechtsmaterie des besonderen Sicherheitsrechtesdar und dient insoweit primär Zielen der Gefahrenabwehr.[4]
7
Hinweis
Daher wird das Bauordnungsrecht häufig auch als Baupolizeirecht bezeichnet.
Soweit die BayBO verfahrensrechtliche Bestimmungen enthält, verdrängt sie als das speziellere Gesetz das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. Art. 1 Abs. 1 S. 1 BayVwVfG).
Als weiteren landesrechtlichen Regelungskomplex gilt es in Bayern noch die Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau)[5] zu beachten, die abweichende Regelungen zur allgemeinen Zuständigkeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren schafft (vgl. Art. 53 Abs. 2 BayBO).
3. Zusammenhänge zwischen öffentlichem und privatem Baurecht
8
Privates und öffentliches Baurecht stehen grundsätzlich selbstständig nebeneinander. So prüft die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auch nur die Übereinstimmung des Vorhabens mit öffentlich-rechtlichen Vorschriften, vgl. Art. 68 Abs. 1 S. 1 BayBO, der bestimmt, dass die Baugenehmigung zu erteilen ist, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriftenentgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind. Weiter normiert Art. 68 Abs. 4 BayBO, dass die Baugenehmigung unbeschadet von RechtenDritter erteilt wird.
JURIQ-Klausurtipp
Читать дальше