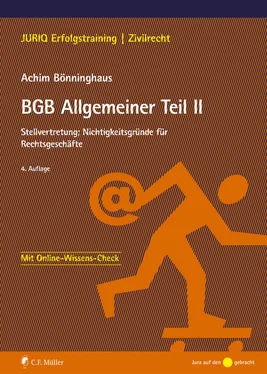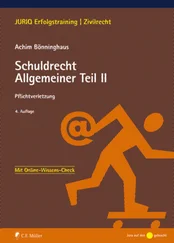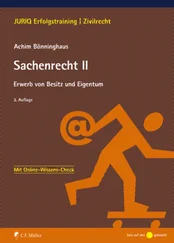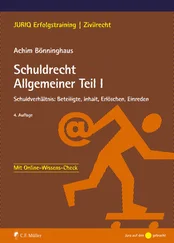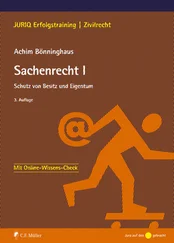II. Handeln unter fremdem Namen
25

Wenn der Stellvertreter bei Abgabe seiner Erklärung einen fremden Namen benutzt, muss zunächst wieder im Wege der Auslegung gem. §§ 133 , 157genau untersucht werden, wer nach seiner Erklärung Beteiligter des Rechtsgeschäfts sein soll: er selber als Handelnder oder der wahre Namensträger.[2] Entscheidend ist, welche Rolle der Name für das konkrete Rechtsgeschäft spielt und ob es dem Erklärungsempfänger vernünftigerweise darauf ankommt, unbedingt mit der Person des Namensträgers und nicht mit der handelnden Person das Rechtsgeschäft vorzunehmen. Bei Bargeschäften unter Anwesenden ist im Zweifel davon auszugehen, dass ein Geschäft der handelnden Person gewollt ist. Anders hingegen, wenn bei einem Vertrag kein sofortiger Leistungsaustausch stattfindet oder wenn das Rechtsgeschäft unter Abwesenden vorgenommen wird, da der Name für die spätere Abwicklung zur Identifizierung des Vertragspartners entscheidend ist.[3] Außerdem kann der Name eine entscheidende Rolle spielen, wenn etwa Fertigkeiten des Namensträgers oder dessen Berühmtheit ausschlaggebend für das Rechtsgeschäft sind.[4]
26
Führt die Auslegung dazu, dass Geschäftspartner die handelnde Person und nicht der wahre Namensträger sein soll, liegt ein Eigengeschäft der handelnden Person unter falscher Namensangabe vor. Auf die Vertretungsmacht kommt es nicht mehr an.
Beispiel
A möchte einen Kongress besuchen und seine Geliebte mitnehmen. Damit seine Frau von der Affäre nichts erfährt, geht er in Absprache mit seinem ledigen Kollegen K, der den Kongress ebenfalls besuchen wird, folgendermaßen vor: A bucht beim Hotelier H ein Doppelzimmer unter Angabe des Namens „K“, K bucht hingegen ein Einzelzimmer unter Angabe des Namens „A“. H weiß von dem „Namenstausch“ nichts. Von wem kann der H die Zahlung des Doppelzimmers beanspruchen?

[Bild vergrößern]
Ein Anspruch des H auf Bezahlung des Doppelzimmers gegen A aus Vertrag setzt notwendig voraus, dass zwischen A und H ein Beherbergungsvertrag über das Doppelzimmer zustande gekommen ist. Beide Parteien haben sich auf die Buchung eines Doppelzimmers geeinigt. Fraglich ist allein, wer nach den Erklärungen Vertragspartner des H sein sollte. Insoweit kommen nach den wechselseitigen Erklärungen einmal der A als persönlich handelnde Person selbst und zum anderen der K als Namensträger in Betracht. Wer Vertragspartner werden soll, ist hier durch Auslegung gemäß §§ 133, 157 zu ermitteln. Ein besonderes Interesse des H, den Vertrag gerade mit dem wahren Namensträger schließen zu wollen, ist nicht ersichtlich. Die Eigenschaft als Namensträger spielt bei der Durchführung dieses Vertrages keine Rolle. Im Gegenteil hat der Hotelier ein besonderes Interesse daran, dass der Vertragspartner auch die tatsächlich handelnde Person ist. Zum einen mag er den Abschluss eines Beherbergungsvertrages auch von dem persönlichen Erscheinen und Auftreten des Gastes abhängig machen wollen („Gesichtskontrolle“). Zum anderen erleichtert ihm die persönliche Kenntnisnahme seines Vertragspartners später auch die Durchsetzung seiner Ansprüche, etwa wenn der Gast wieder abreisen will und die Rechnung noch nicht bezahlt hat. Da A umgekehrt nicht deutlich gemacht hat, dass Vertragspartner eine andere Person werden solle, führt die Auslegung im Ergebnis zu einem Vertragsschluss zwischen A und dem H. A ist folglich aus dem mit H geschlossenen Vertrag zur Zahlung des Doppelzimmers verpflichtet.
27
Ergibt die Auslegung der Erklärungen, dass das Rechtsgeschäft mit dem wahren Namensträger zustande kommen sollte, die handelnde Person aber eben nicht der tatsächliche Namensträger ist, sind nach allgemeiner Auffassung die Vorschriften über die Stellvertretung analog anzuwenden, obwohl der handelnden Person der Vertretungswille fehlte.[5] Hatte der Handelnde Vertretungsmacht[6] für den Namensträger, ist der Vertrag unmittelbar wirksam (§ 164 Abs. 1 analog). Ansonsten gelten §§ 177, 179 analog.[7]
Beispiel
K hat bei V im Internet ein Sofa gekauft und bezahlt. K soll das Sofa abholen. Betrüger B erscheint bei V und gibt sich als K aus und nimmt das Sofa mit. Hier ergibt die Auslegung der Einigung nach § 929 S. 1, dass V das Eigentum am Sofa an den Namensträger K übertragen möchte und nicht an den B. Nur bei Übereignung an K könnte V sicher sein, seine Verpflichtung aus dem Kaufvertrag gem. § 433 Abs. 1 S. 1 zu erfüllen (vgl. § 362 Abs. 1).
2. Teil Die Stellvertretung› B. Offenkundigkeitsprinzip› III. Unternehmensbezogenes Rechtsgeschäft
III. Unternehmensbezogenes Rechtsgeschäft
28

[Bild vergrößern]
Beispiel
K geht in einem „TOP“-Supermarkt in Düsseldorf einkaufen, der von der „TOP Region West GmbH & Co KG“ betrieben wird. Er entnimmt aus den Regalen die Waren, die er erwerben möchte und legt sie an der Kasse auf das Band der Kassiererin. Die Kassiererin A nimmt die Waren und zieht sie über den „Scanner“ und verlangt sodann den Kaufpreis von K. Wer ist Vertragspartner des K?
29
Im Alltag haben wir sehr häufig keine Vorstellung, wer eigentlich unser Vertragspartner ist. Das liegt daran, dass viele Unternehmen ihre rechtliche Struktur im Alltag nicht immer exakt offenlegen oder wir uns darüber gar keine Gedanken machen (wollen). Dies scheint aber mit dem Grundsatz zu kollidieren, dass sich aus den bei Abschluss eines Vertrages abgegebenen Willenserklärungen die Vertragspartner ergeben müssen. Allerdings müssen die Vertragspartner nicht namentlich bezeichnet werden, sondern es genügt, wenn sie anhand der Erklärung zumindest bestimmbar sind.
30

Bei Rechtsgeschäften mit Unternehmern (§ 14) hat sich die „Lehre vom unternehmensbezogenen Geschäft“herausgebildet, die den Unsicherheiten über die Bestimmbarkeit des hinter dem Unternehmen stehenden Rechtssubjektes Rechnung trägt.
Wenn der Vertreter immerhin deutlich gemacht hat, für ein bestimmtes Unternehmen auftreten zu wollen,gilt eine besondere Auslegungsregel.Nach dieser geht der Wille der Beteiligten im Zweifel dahin, dass Vertragspartner der tatsächliche Träger des Unternehmenswerden soll.[8] Dieser ist schließlich eindeutig bestimmbar. Die Auslegungsregel gilt im Zweifel auch dann, wenn der Inhaber falsch bezeichnet wird oder über ihn sonst Fehlvorstellungen bestehen.[9]
Lösung
Im Beispiel unter Rn. 28ergibt sich aus den Umständen, § 164 Abs. 1 S. 2, dass die Kassiererin nicht im eigenen Namen, sondern für das Unternehmen „TOP“ auftritt.
Die Erklärungen von K und A sind deshalb so auszulegen, dass Vertragspartner des K diejenige Person sein soll, die tatsächlich Inhaber des konkreten Filialbetriebs ist. Wen sich der K dabei vorgestellt hat (etwa „die TOP-AG“ oder „die TOP-GmbH“) ist dabei unbeachtlich, sofern er nicht deutlich gemacht hat, den Vertrag unbedingt mit einer bestimmten Person schließen zu wollen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Der Vertrag ist daher zwischen dem K und der TOP Region West GmbH & Co KG zustande gekommen.
Читать дальше