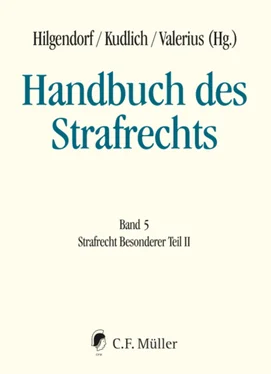[655]
LK- Sowada , § 316a Rn. 60 (versuchter Raub als „regelmäßige Begleittat“); Sch/Sch- Hecker , § 316a Rn. 21; Bosch , JA 2013, 1234, 1237; Geppert , Jura 1995, 310, 316; Mitsch , BT/2, S. 642 f. (Konsumtion); s.a. BGHSt 25, 373 zu § 316a StGB a.F.
[656]
AnwK- Esser , § 316a Rn. 33; MK- Sander , § 316a Rn. 55; NK- Zieschang , § 316a Rn. 57.
[657]
Vgl. etwa MR- Renzikowski , § 316a Rn. 24; LK- Sowada , § 316a Rn. 60 m.w.N., allerdings nicht für die versuchte Qualifikation nach § 251 StGB, da das Unrecht durch § 316a Abs. 3 StGB hinreichend klargestellt werde; Bosch , JA 2013, 1234, 1237; s.a. BGH BeckRS 2005, 11162; BeckRS 2010, 21240.
[658]
AnwK- Esser , § 316a Rn. 33.
[659]
LK- Sowada , § 316a Rn. 61.
[660]
BGHSt 52, 44.
[661]
BGH NStZ 2004, 626; Fischer , § 316a Rn. 20.
[662]
Lackner/Kühl- Heger , § 316a Rn. 8; NK- Zieschang , § 316a Rn. 57; Sch/Sch- Hecker , § 316a Rn. 21; SK- Wolters , § 316a Rn. 17; Geppert , Jura 1995, 310, 316; s.a. BGH NStZ 2003, 371.
[663]
NK- Zieschang , § 316a Rn. 57; einschlägig ist dann der § 316a Abs. 3 StGB.
[664]
BGH NStZ 1993, 540 (= BGHSt 39, 249, allerdings hier nicht abgedr.); Fischer, § 316a Rn. 20.
[665]
BGH BeckRS 1980, 30381106.
[666]
BGH BeckRS 2006, 12631.
[667]
BGHSt 49, 8, 10 f.
[668]
S.a. die übersichtliche Darstellung bei MK- Sander , § 316a Rn. 54.
[669]
LK- Vogel , Vor §§ 249 ff. Rn. 75 ff.; Hagel , Raub und Erpressung nach englischem und deutschem Recht und aus rechtsvergleichender Sicht, 1979, S. 563.
[670]
LK- Vogel , Vor §§ 249 ff. Rn. 75; für das englische Recht vgl. Ashworth , Principles of Criminal Law, 2009, S. 383.
[671]
LK- Vogel , Vor §§ 249 ff. Rn. 72.
[672]
LK- Vogel , Vor §§ 249 ff. Rn. 74.
[673]
LK- Vogel , Vor §§ 249 ff. Rn. 74; Marinucci , Codice penale commentato, 2006, Art. 628 Rn. 10.
[674]
LK- Vogel , Vor §§ 249 ff. Rn. 70.
[675]
Rusam , Der räuberische Angriff auf Kraftfahrer, S. 98.
8. Abschnitt: Schutz des Vermögens› § 32 Erpressung und räuberische Erpressung
Bernd Heinrich
§ 32 Erpressung und räuberische Erpressung
A. Einführung1
B.Rechtshistorische und kriminologische Grundfragen2 – 30
I. Historische Entwicklung des Erpressungstatbestands2 – 27
1. Ursprünge des Erpressungsstrafrechts3
2. Die Erpressung in den Partikularstrafgesetzen des 19. Jahrhunderts4 – 13
a) Die Erpressung in den außerpreußischen Kodifikationen des 19. Jahrhunderts5 – 10
b) Die Erpressung im Preußischen Strafgesetzbuch von 185111 – 13
3. Die Erpressung im Reichsstrafgesetzbuch von 187114 – 17
4. Die Erpressung in den Reformentwürfen des Kaiserreichs und der Weimarer Republik18 – 21
5. Die Erpressung im Nationalsozialismus22 – 24
6. Die Erpressung in der Nachkriegszeit25 – 27
II. Kriminologische Bedeutung und Erscheinungsformen der Erpressung28 – 30
C.Hauptteil31 – 105
I. Grundstrukturen der Erpressungstatbestände31 – 33
II. Abgrenzung von Raub und (räuberischer) Erpressung34 – 45
1. Die Ansicht der Rechtsprechung35 – 40
2. Die abweichende Ansicht in der Literatur41 – 45
III.Die „einfache“ Erpressung, § 253 StGB46 – 101
1. Einführung46, 47
2. Die Nötigungsmittel48 – 54
3. Der Nötigungserfolg55
4. Die Vermögensverfügung56 – 62
5. Nötigungsziel: Vermögensschaden63 – 69
6. Ursachen- und Zurechnungszusammenhang70
7. Sonderfall: Die Dreieckserpressung71 – 73
8. Der subjektive Tatbestand74 – 84
a) Vorsatz75
b) Bereicherungsabsicht76 – 84
9. Die Rechtswidrigkeit85 – 88
10.Sonstige Fragen89 – 99
a) Beteiligung89 – 91
b) Notwehrbefugnisse des Opfers92
c) Versuch93
d) Besonders schwere Fälle94
e) Konkurrenzen95 – 99
11. Nebenfolgen100
12. Sonderproblem: Chantage101
IV.Die räuberische Erpressung, § 255 StGB102 – 105
1. Tatbestandliche Voraussetzungen102 – 104
2. Rechtsfolgen105
D.Rechtsvergleich106 – 109
I. Strafrecht der DDR106
II. Österreichisches und schweizerisches Strafrecht107
III. Angelsächsischer Rechtskreis108
IV. Romanischer Rechtskreis109
E. Bezüge zum Strafverfahrensrecht110
F. Fazit111
Ausgewählte Literatur
8. Abschnitt: Schutz des Vermögens› § 32 Erpressung und räuberische Erpressung› A. Einführung
1
Die Erpressung, geregelt in § 253 StGB, zählt heute zu den klassischen Vermögensdelikten. In ihrer Sonderform, der räuberischen Erpressung, § 255 StGB, ist sie zudem als raubähnliches Delikt ausgestaltet, welches, wie der Raub, § 249 StGB, die Nötigungsmittel „Gewalt gegen eine Person“ und „Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben“ verlangt. Bevor daher Detailfragen geklärt werden können, muss insoweit die Systematik der Vermögensdelikte dargestellt und die (räuberische) Erpressung hierin eingeordnet werden. Eindeutig ist, dass es sich sowohl bei der einfachen als auch bei der räuberischen Erpressung jeweils um ein Vermögensverschiebungsdelikthandelt, wobei der Vermögensschaden auf der Opferseite tatsächlich eingetreten sein muss, während die (stoffgleiche) Bereicherung auf der Täterseite lediglich angestrebt werden muss, um das Delikt zu vollenden. Daneben herrscht aber insbesondere Streit darüber, ob diese Vermögensverschiebung durch das genötigte Opfer mittels einer (erzwungenen) Vermögensverfügung stattfinden muss, oder ob auch eine gewaltsame Wegnahme in Form der vis absoluta für die (räuberische) Erpressung ausreicht, womit sich zwingend die Frage der Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung stellt.[1]
8. Abschnitt: Schutz des Vermögens› § 32 Erpressung und räuberische Erpressung› B. Rechtshistorische und kriminologische Grundfragen
B. Rechtshistorische und kriminologische Grundfragen
I. Historische Entwicklung des Erpressungstatbestands
2
Die Straftatbestände der Erpressung und der räuberischen Erpressung sind in ihrer heutigen Form vergleichsweise jung.[2] Zwar gab es durchaus Vorläufer, die auch bereits im römischen Recht zu finden sind, die damaligen Tatbestände sind jedoch mit den heutigen kaum vergleichbar, da sie den spezifisch vermögensstrafrechtlichen Aspekt noch nicht in den Mittelpunkt stellten. Ebenso wie der Betrug, ist die Erpressung als Vermögens(verschiebungs)delikt daher ein Kind der vermögensstrafrechtlich geprägten Entwicklung des 19. Jahrhunderts.[3]
1. Ursprünge des Erpressungsstrafrechts
3
Das römische Recht kannte nur den schillernden Tatbestand der „ concussio“ bzw. der „ concussio publica“[4], dessen Anwendungsbereich allerdings auf das Erlangen von ungerechtfertigten Vermögensvorteilen durch Amtsmissbrauch oder durch die Androhung von Kriminalstrafen beschränkt war.[5] Im gemeinen Recht wurde die „concussio“ nur vereinzelt rezipiert,[6] ein allgemeiner Erpressungstatbestand als Schutz gegen Angriffe auf das Vermögen als solches war dem deutschen Recht aber lange fremd.[7] Zu einer Kodifizierung der Erpressung kam es im deutschsprachigen Rechtsraum erstmals mit der Normierung der Concussion in § 1254 II 20 im Preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794. Dabei handelte es sich um einen Spezialfall der Nötigung (zum Abschluss eines nachteiligen Vertrags) durch „Concussion“ als crimen extraordinarium, sofern dadurch entgeltlos Geld oder andere Sachen hingegeben wurden. In § 1255 II 20 ALR ebenfalls bereits vorgesehen war, dass eine Erpressung unter Anwendung von Raubmitteln zur Verwirkung der Raubstrafen führen sollte.
Читать дальше