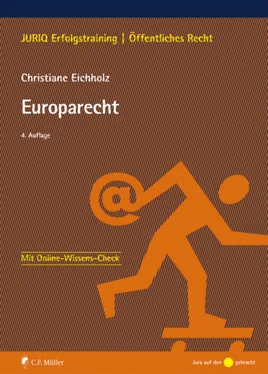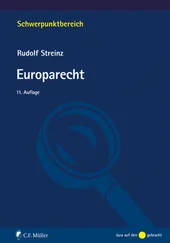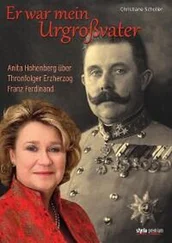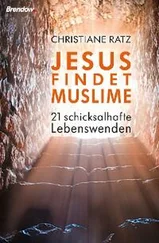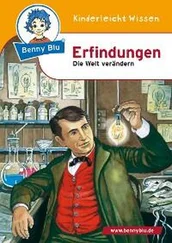Vor und nach dem Mittagessen sollte eine längere Erholungspause von mindestens 30 Minuten eingeplant werden, d.h. insgesamt mindestens 60 Minuten lernfreie Zeit. Ein Power Napping von ca. 20 Minuten nach dem Mittagsessen reicht oft aus. Dann ist man besonders fit. Von Arbeitsphysiologen wird der kurze und tiefe Mittagsschlaf empfohlen, womit dem Leistungstief von 13 bis 14 Uhr entgegengewirkt werden kann. Der Magen wird nach dem Mittagessen mit viel sauerstoffreichem Blut versorgt. Das fehlt ihrem Gehirn in dieser Phase also so oder so. Und durch das Nickerchen werden Aufmerksamkeit und Konzentration wieder gesteigert. Aber es sind alle Tätigkeiten erlaubt, die entspannen, schön sind, das Gehirn nicht belasten und fristgerecht beendet werden können.
Lernen am Abend ist weniger effektiv!
Das Lernen am späten Abend – also nach 22 Uhr ist wenig effektiv, da gemessen am Arbeitsaufwand weniger behalten wird. Vermeiden Sie also die Nachmittage mit Fernsehen, Verabredungen, Freizeit zu verbringen und hier viel Freizeitenergie zu investieren. Danach geistige Energie für Lernleistungen aufzubringen, fällt umso schwerer. Bei spätem Lernen schläft man erfahrungsgemäß auch schlechter und das, obwohl der nächste Tag wiederum Ihren vollen Einsatz erfordert. Seien Sie ehrlich zu sich und schauen Sie einmal, von welcher abendlichen Uhrzeit an die Lerneffektivität nachlässt.
Planen Sie mindestens 60 Minuten vor dem Schlafengehen vollkommen zum Entspannen ein. Sie können so mehr Abstand zum Lernen gewinnen und der Schlaf wird umso erholsamer sein. Andernfalls grübeln Sie weiter über Ihren Lernstoff, und Sie stehen am nächsten Morgen mit einem „Lernkater“ auf. Alkohol oder Schlafmittel beeinträchtigen die Lernarbeit im Schlaf erheblich. Nur im erholsamen Schlaf arbeitet das Gehirn gerne für Sie eigenverantwortlich weiter.
Den Schlaf als Lernorganisator nutzen!
Es ist nachgewiesen, dass sich unser Gehirn während des Schlafens nicht ausruht, der Arbeitsmodus schaltet um und das Gehirn wird zum Verwalter und Organisator des Gelernten. Das Gehirn bzw. die neuronale Aktivität sichtet, sortiert und ordnet zu, schafft Verbindungen (Synapsen) zu bereits bestehenden Wissensinhalten und verankert Gelerntes – ohne dass wir bewusst und aktiv etwas tun müssen. Diese Erkenntnisse erklären wahrscheinlich auch die lernförderlichen Wirkungen des Kurzschlafes (Power Napping) und der kurzen und tiefen Entspannung mit Hypnose.
1. Teil Die europäische Integration
Inhaltsverzeichnis
A. A. Ablauf der Gründung der Europäischen Gemeinschaft 1 JURIQ-Klausurtipp Für eine gute Fallbearbeitung ist das Wissen um die Details der europäischen Integration insbesondere bezogen auf den Kompetenzzuwachs der einzelnen Organe nötig, weswegen wir uns nachfolgend zunächst mit diesem Thema beschäftigen werden. 1. Teil Die europäische Integration › A. Ablauf der Gründung der Europäischen Gemeinschaft › I. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
Ablauf der Gründung der Europäischen Gemeinschaft A. Ablauf der Gründung der Europäischen Gemeinschaft 1 JURIQ-Klausurtipp Für eine gute Fallbearbeitung ist das Wissen um die Details der europäischen Integration insbesondere bezogen auf den Kompetenzzuwachs der einzelnen Organe nötig, weswegen wir uns nachfolgend zunächst mit diesem Thema beschäftigen werden. 1. Teil Die europäische Integration › A. Ablauf der Gründung der Europäischen Gemeinschaft › I. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
B. B. Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft 7 Mit der Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft sollte die Rolle des Europäischen Parlamentes gestärkt, das Entscheidungsverfahren im Rat und die Effizienz der Arbeitsweise der Kommission verbessert werden. Dies bedeutete auch die Preisgabe nationalstaatlicher Souveränität . Dies stieß in den Mitgliedstaaten, insbesondere in Frankreich, auf erheblichen Widerstand. Am 15.6.1965 brach Frankreich Verhandlungen zum Agrarfonds ab, da Frankreich einen mit qualifizierter Mehrheit gefassten Beschluss des Rates befürchtete, der nicht im französischen Interesse gewesen wäre. Frankreich sandte danach keinen Vertreter mehr[1] zu den Sitzungen des Rates, der damit beschlussunfähig wurde. Zur Ermittlung der ausreichenden Stimmen für einen mit qualifizierter Mehrheit gefassten Beschluss mussten alle Mitgliedstaaten anwesend sein oder sich von anderen Mitgliedstaaten vertreten lassen. Am 29.1.1966 konnte ein Kompromiss im Rat zur Beilegung der Divergenzen in der Agrarpolitik getroffen werden. Dieser Luxemburger Kompromiss zu Mehrheitsentscheidungen sah vor, dass, soweit Entscheidungen des Rates die vitalen Interessen eines Mitgliedstaates berühren, die Entscheidungen nicht gegen die Stimme dieses Staates getroffen werden dürfen.[2] Durch diesen Kompromiss ist eine Art Gewohnheitsrecht entstanden, nach dem Mitgliedstaaten in wichtigen Fällen solange weiterverhandeln, bis ein Konsens erzielt wird. Zwar ist diese Vereinbarung nicht in den Gesetzestext des EWGV bzw. später den des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) aufgenommen worden, jedoch wird sie in der Praxis eingehalten. Gleiches ist auch in Bereichen, in denen eigentlich eine qualifizierte Mehrheit als ausreichend vorgesehen ist, überwiegend der Fall.[3] Bis zum Jahr 1985 waren die Mitglieder des Rates oft nicht bereit, Mehrheitsentscheidungen zu treffen, da die Mitglieder eine Überstimmung nicht akzeptieren wollten.[4] 1. Teil Die europäische Integration › B. Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft › I. Die Reform der Europäischen Gemeinschaft durch das Schengener Übereinkommen
Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft B. Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft 7 Mit der Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft sollte die Rolle des Europäischen Parlamentes gestärkt, das Entscheidungsverfahren im Rat und die Effizienz der Arbeitsweise der Kommission verbessert werden. Dies bedeutete auch die Preisgabe nationalstaatlicher Souveränität . Dies stieß in den Mitgliedstaaten, insbesondere in Frankreich, auf erheblichen Widerstand. Am 15.6.1965 brach Frankreich Verhandlungen zum Agrarfonds ab, da Frankreich einen mit qualifizierter Mehrheit gefassten Beschluss des Rates befürchtete, der nicht im französischen Interesse gewesen wäre. Frankreich sandte danach keinen Vertreter mehr[1] zu den Sitzungen des Rates, der damit beschlussunfähig wurde. Zur Ermittlung der ausreichenden Stimmen für einen mit qualifizierter Mehrheit gefassten Beschluss mussten alle Mitgliedstaaten anwesend sein oder sich von anderen Mitgliedstaaten vertreten lassen. Am 29.1.1966 konnte ein Kompromiss im Rat zur Beilegung der Divergenzen in der Agrarpolitik getroffen werden. Dieser Luxemburger Kompromiss zu Mehrheitsentscheidungen sah vor, dass, soweit Entscheidungen des Rates die vitalen Interessen eines Mitgliedstaates berühren, die Entscheidungen nicht gegen die Stimme dieses Staates getroffen werden dürfen.[2] Durch diesen Kompromiss ist eine Art Gewohnheitsrecht entstanden, nach dem Mitgliedstaaten in wichtigen Fällen solange weiterverhandeln, bis ein Konsens erzielt wird. Zwar ist diese Vereinbarung nicht in den Gesetzestext des EWGV bzw. später den des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) aufgenommen worden, jedoch wird sie in der Praxis eingehalten. Gleiches ist auch in Bereichen, in denen eigentlich eine qualifizierte Mehrheit als ausreichend vorgesehen ist, überwiegend der Fall.[3] Bis zum Jahr 1985 waren die Mitglieder des Rates oft nicht bereit, Mehrheitsentscheidungen zu treffen, da die Mitglieder eine Überstimmung nicht akzeptieren wollten.[4] 1. Teil Die europäische Integration › B. Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft › I. Die Reform der Europäischen Gemeinschaft durch das Schengener Übereinkommen
Читать дальше