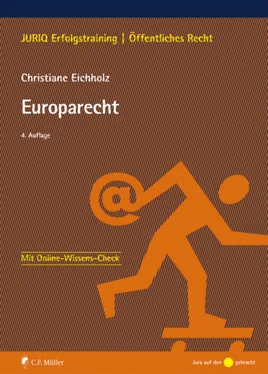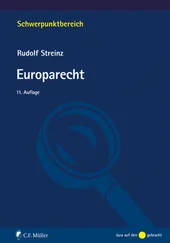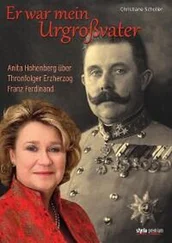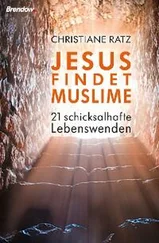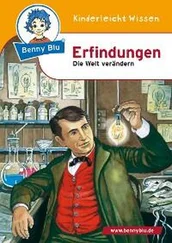2. 2. Die Änderungen bezüglich der Institutionen 12 Die Abstimmungsmodalitäten im Rat wurden geändert. Eine qualifizierte Mehrheit reichte für Abstimmungen im Rat bei vielen Beschlussverfahren nun aus. Einstimmige Ratsbeschlüsse waren weiterhin für Abstimmungen über Steuern, die Freizügigkeit der Arbeit und die Rechte der Arbeitnehmer notwendig. Auf Initiative des Ratspräsidenten, auf Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaates konnte nun eine Abstimmung des Rates verlangt werden. In der EEA wurden die Befugnisse des Europäischen Parlaments gestärkt, da von nun an seine Zustimmung zu Erweiterungs- und Assoziierungsabkommen der Gemeinschaft erforderlich war. Außerdem wurde im gesetzgebenden Bereich das Zusammenarbeitsverfahren zwischen Parlament und Rat eingeführt. 1. Teil Die europäische Integration › B. Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft › III. Die Reform der Europäischen Gemeinschaft durch den Vertrag von Maastricht
Die Änderungen bezüglich der Institutionen 2. Die Änderungen bezüglich der Institutionen 12 Die Abstimmungsmodalitäten im Rat wurden geändert. Eine qualifizierte Mehrheit reichte für Abstimmungen im Rat bei vielen Beschlussverfahren nun aus. Einstimmige Ratsbeschlüsse waren weiterhin für Abstimmungen über Steuern, die Freizügigkeit der Arbeit und die Rechte der Arbeitnehmer notwendig. Auf Initiative des Ratspräsidenten, auf Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaates konnte nun eine Abstimmung des Rates verlangt werden. In der EEA wurden die Befugnisse des Europäischen Parlaments gestärkt, da von nun an seine Zustimmung zu Erweiterungs- und Assoziierungsabkommen der Gemeinschaft erforderlich war. Außerdem wurde im gesetzgebenden Bereich das Zusammenarbeitsverfahren zwischen Parlament und Rat eingeführt. 1. Teil Die europäische Integration › B. Die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft › III. Die Reform der Europäischen Gemeinschaft durch den Vertrag von Maastricht
III.Die Reform der Europäischen Gemeinschaft durch den Vertrag von Maastricht
1. Die Gründung der Europäischen Union (EU)
a) Die GASP
b) Die PJZS
2. Die Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
3. Der Unionsbürger nach Maastricht
a) Die Rechte des Unionsbürgers
b) Die Rechte der Familienangehörigen, die nicht Unionsbürger sind
4. Die Änderungen bezüglich der Institutionen
5. Die deutsche Verfassungsbeschwerde gegen den Maastricht-Vertrag
IV. Die Reform der Europäischen Gemeinschaften durch den Vertrag von Amsterdam
1. Die weiteren Vergemeinschaftungen
2. Die Änderungen bezüglich der Institutionen
3. Das Europa der zwei Geschwindigkeiten
V. Die Reform der Europäischen Gemeinschaft durch den Vertrag von Nizza vom 26.2.2001
1. Die Änderungen bezüglich der Institutionen
2. Die Charta der Grundrechte der EU
3. Die weiteren Vergemeinschaftungen
VI. Die Reform der Europäischen Gemeinschaft durch die Europäische Verfassung
VII. Die Reform der Europäischen Gemeinschaft durch den Vertrag von Lissabon
1.Die Zustimmung in den Mitgliedstaaten
a) Das irische Referendum
b) Die deutsche Zustimmung
c) Die Unterzeichnung in Polen und Tschechien
2. Die Neuerungen im Vertragstext von Lissabon
3. Maßnahmen zur Koordinierung und Überwachung der Haushaltsdisziplin in den EURO-Staaten
4. Bankenaufsicht
C. Die Erweiterungen der Europäischen Gemeinschaft
2. Teil Die Rechtsnatur der Europäischen Union
A. Die Rechtsnatur der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union bis zum Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages
B. Die Rechtsnatur der Europäischen Union nach dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages
I. Der Beitritt zur Union
a) Die politischen Kriterien
b) Die wirtschaftlichen Kriterien
c) Das Acquis-Kriterium
II. Der Austritt nach dem Vertrag von Lissabon
III. Die Änderung des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaates
3. Teil Der Anwendungs- oder Geltungsvorrang des Unionsrechts
A. Die unmittelbare Anwendbarkeit des Unionsrechts
B. Der Anwendungsvorrang
I. Die Begründung des BVerfG zum Anwendungsvorrang des unmittelbar anwendbaren Unionsrechts
II. Die Begründung des EuGH zum Anwendungsvorrang des unmittelbar anwendbaren Unionsrechts
C. Der Geltungsvorrang
4. Teil Quellen des Unionsrechts
A. Das Primärrecht
I. Die Gründungsverträge
II. Die Protokolle, Anhänge und Erklärungen
III. Die allgemeinen Rechtsgrundsätze
IV. Das Gewohnheitsrecht
B. Die völkerrechtlichen Verträge
C. Das Sekundärrecht
I. Die Verordnung
II. Die Richtlinie
1. Die nationale Umsetzung
2. Die unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie im Verhältnis des Einzelnen zum Staat
3. Der unionsrechtliche Staatshaftungsanspruch
4. Die unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie im Verhältnis der Bürger zueinander
5. Die Vorwirkung der noch nicht umzusetzenden Richtlinie
6. Die Sperrwirkung der umgesetzten Richtlinie
III. Die Beschlüsse
IV. Empfehlungen und Stellungnahmen
V. Übungsfall Nr. 1
D. Sekundärrechtliche Normen im Bereich der GASP, im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und des Datenschutzrechts
I. Sekundärrechtsnormen im Bereich der GASP nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages
II. Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
III. Das Datenschutzrecht
5. Teil Das institutionelle System der Union
A. Die Unionsorgane
I. Das Europäische Parlament gem. Art. 14 EUV
1. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments
2.Die Kompetenzen des Europäischen Parlamentes
a) Die parlamentarische Beteiligung an der Gesetzgebung und an der Haushaltsaufstellung
b) Die Kontrollrechte
3. Die Nähe zum Unionsbürger
II. Der Europäische Rat gem. Art. 15 EUV
1. Die Organisation des Europäischen Rates
2. Die Kompetenzen des Europäischen Rates
III. Der Rat gem. Art. 16 EUV
1. Die Zusammensetzung des Rates
2. Die Kompetenzen
a) Die Beteiligung des Rates an der Gesetzgebung
b) Die Beteiligung des Rates an der Haushaltsaufstellung
c) Die Kontrollrechte
d) Die Koordination der Wirtschaftspolitik
3. Die Nähe zum Unionsbürger
IV. Die Kommission gem. Art. 17 EUV
1. Die Zusammensetzung der Kommission
2. Die Kompetenzen der Kommission
a) Die Beteiligung der Kommission an der Gesetzgebung und an der Haushaltsaufstellung
b) Die Kontrollrechte
c) Die Beschlüsse der Kommission
V. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) gem. Art. 19 EUV
1. Die Zusammensetzung des EuGH
2. Die Organisation des EuGH
a) Das Gericht
b) Die Fachgerichte
3. Die Sprachenregelung beim EuGH, Gericht und EuGD
4. Die Nähe zum Unionsbürger
VI. Die Europäische Zentralbank (EZB) gem. Art. 129 und Art. 282 ff. AEUV
1. Der EZB-Rat
2. Das EZB-Direktorium
VII.Der Europäische Rechnungshof (ERH)
1. Die Zusammensetzung
2. Die Kompetenzen
VIII. Der Sitz der Unionsorgane gem. Art. 13 EUV
B. Die Hilfsorgane der Union
Übungsfall Nr. 2
6. Teil Das Rechtsetzungsverfahren
A. Die Grundlagen für die Rechtsetzungskompetenz der Union
I. Die ausdrückliche Rechtsetzungskompetenz
1. Die ausschließliche Rechtsetzungskompetenz
2. Die geteilte Rechtsetzungskompetenz
3. Die unterstützende Rechtsetzungskompetenz
II. Die Vertragsabrundungskompetenz gem. Art. 352 AEUV
III. Die Zuständigkeit kraft Sachzusammenhangs nach der Implied-Powers-Lehre
IV. Mehrere mögliche Kompetenznormen
B. Die verschiedenen Rechtsetzungsverfahren
Читать дальше