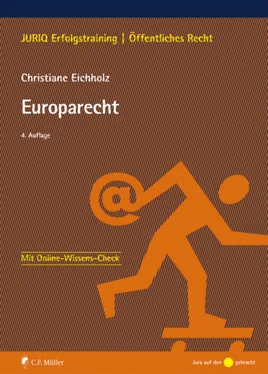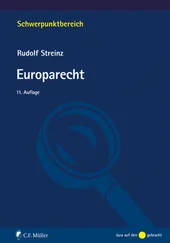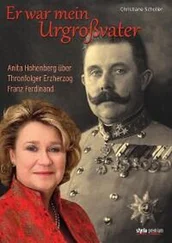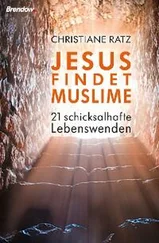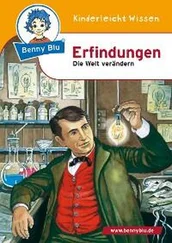I. Die unterschiedlich starke Beteiligung der Organe der EG am Rechtsetzungsverfahren
II. Die verschiedenen Rechtsetzungsverfahren
1. Das ordentliche Rechtsetzungsverfahren gem. Art. 289 Abs. 1 AEUV
2. Das besondere Rechtsetzungsverfahren gem. Art. 289 Abs. 2 AEUV
a) Das Anhörungsverfahren
b) Das Zustimmungsverfahren
3. Der Erlass von Rechtsakten ohne Rechtsetzungsverfahren
7. Teil Das Rechtsschutzsystem
A. Allgemeines zu dem Verfahren vor dem EuGH
I.Die Auslegungsregeln
1. Die klassischen Auslegungsmethoden
2. Die Rechtsfortbildung durch die europäischen Gerichte
II. Die fünf Verfahrensabschnitte
B. Die verschiedenen Verfahrensarten
I. Das Vorabentscheidungsverfahren
1. Die Zulässigkeit der Vorlage
a) Die sachliche Zuständigkeit
b) Die Vorlageberechtigung
c) Die zulässige Vorlagefrage
d) Die Entscheidungserheblichkeit
e) Die Vorlagepflicht
f) Das Vorlagerecht
g) Die Frist für die Einreichung der Vorlagefrage
2. Die Vorlageentscheidung
3. Die Wirkung der Vorabentscheidung
a) Die Auslegungsfrage
b) Die Gültigkeitsfrage
II. Das Vertragsverletzungsverfahren
1.Die Zulässigkeit
a) Die sachliche Zuständigkeit
b) Die Beteiligtenfähigkeit
c) Der Klagegegenstand
d) Das Vorverfahren gem. Art. 258 AEUV
e) Das Vorverfahren gem. Art. 259 AEUV
f) Die Klagefrist
g) Das Rechtsschutzinteresse
2. Die Begründetheit
3. Die Wirkung der Entscheidung bei Untätigkeit des verurteilten Staates
4. Verurteilung zur Pauschalbetrags- oder/und Zwangsgeldzahlung
III. Die Nichtigkeitsklage
1.Die Zulässigkeit
a) Die sachliche Zuständigkeit
b) Die Beteiligtenfähigkeit
c) Der Klagegegenstand
d) Die Klagebefugnis
e) Die Klagegründe
f) Die Klagefrist
2. Die Begründetheit
3. Die Wirkung der Entscheidung
IV. Die Untätigkeitsklage
1.Die Zulässigkeit
a) Die sachliche Zuständigkeit
b) Die Beteiligtenfähigkeit
c) Das Vorverfahren
d) Der Klagegegenstand
e) Die Klagebefugnis
f) Die Klagefrist
2. Die Begründetheit
V. Die Amtshaftungsklage
1.Die Zulässigkeit
a) Die Zuständigkeit
b) Die Beteiligtenfähigkeit
c) Der Klagegegenstand
d) Die Klagefrist
e) Das Rechtsschutzinteresse
2. Die Begründetheit
a) Die materiellen Voraussetzungen des Amtshaftungsanspruches
b) Die Entscheidung des EuGH
C. Der zulässige Vorläufige Rechtsschutz auf nationaler Ebene
D. Die Problemlösung durch SOLVIT
I.Die falsche Anwendung des Unionsrechts
1. Der Aktionsplan von 1997
2. Die Gründung von SOLVIT
a) Die Koordinierungsstellen
b) Die Abgrenzung zu gerichtlichen Verfahren
3. Die Tätigkeitsbereiche von SOLVIT
4. Übungsfall Nr. 3
5. Übungsfall Nr. 4
8. Teil Die vier Grundfreiheiten
A. Die Einführung in die Grundfreiheiten
I.Die Berechtigten der Grundfreiheiten
1. Die Berechtigung der Unionsbürger
2. Die Übergangsregelungen für die Unionsbürger aus den osteuropäischen Mitgliedstaaten
3.Die Berechtigung von Staatsangehörigen aus Drittstaaten
a) Die Berechtigung aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen
b) Die Berechtigung von Familienangehörigen von Unionsbürgern
4.Die Berechtigung von juristischen Personen
a) Die gesetzlich normierte Berechtigung bzgl. der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
b) Die entsprechende Berechtigung bzgl. der übrigen Grundfreiheiten
II.Die Adressaten der Grundfreiheiten
1. Die Mitgliedstaaten und Unionsorgane als Adressaten
2. Die Privatpersonen und nicht-staatlichen Einrichtungen als Adressaten
III.Der Charakter der Grundfreiheiten
1. Das Diskriminierungsverbot
a) Die Inländerdiskriminierung
b) Die Rückkehrfälle
2. Das Beschränkungsverbot
a) Die Beweislastumkehr
b) Die Einschränkung der Interpretation als Beschränkungsverbot
c) Die Übertragung der Keck-Rechtsprechung auf die übrigen Grundfreiheiten
3. Die unmittelbare Anwendbarkeit
IV. Die Rechtfertigung von Grundfreiheitsbeschränkungen
1. Die geschriebenen Rechtfertigungsgründe
2. Die Bereichsausnahmen
3. Die ungeschriebenen Rechtfertigungsgründe
a) Die zwingenden Erfordernisse
b) Die Voraussetzungen für die Beschränkung durch ungeschriebene Rechtfertigungsgründe
B. Die vier Grundfreiheiten
I. Die Warenverkehrsfreiheit
1.Die Zollunion
a) Die Bedeutung der Zollunion
b) Die Rechtfertigung von Beschränkungen
2. Der freie Warenverkehr
a) Der Schutzbereich
b) Der Eingriff in den Schutzbereich
c) Die Rechtfertigungsgründe
3. Die Umformung staatlicher Handelsmonopole
4. Die Landwirtschaft und die Fischerei gem. Art. 38 bis 44 AEUV
II. Die Personenverkehrsfreiheit
1. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit
a) Der persönliche Schutzbereich
b) Der sachliche Schutzbereich
c) Der räumliche Schutzbereich
d) Die Bereichsausnahme für die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung
e) Der Eingriff in den Schutzbereich
f) Die Rechtfertigungsgründe
2. Die Niederlassungsfreiheit
a) Der persönliche Schutzbereich
b) Der sachliche Schutzbereich
c) Der räumliche Schutzbereich
d) Die Bereichsausnahme für die Ausübung öffentlicher Gewalt
e) Der Eingriff in den Schutzbereich
f) Die Rechtfertigungsgründe
3. Übungsfall Nr. 5
III. Die Dienstleistungsfreiheit
1.Der Schutzbereich
a) Der persönliche Schutzbereich
b) Der sachliche Schutzbereich
c) Der räumliche Schutzbereich
2.Der Eingriff in den Schutzbereich
a) Der Schutz vor staatlichen Beschränkungen
b) Der Schutz vor Beschränkungen durch Privatpersonen und nicht-staatliche Einrichtungen
3. Die Rechtfertigungsgründe
4. Übungsfall Nr. 6
IV. Die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit
1. Der Schutzbereich
2. Der Eingriff in den Schutzbereich
3. Die Rechtfertigungsgründe
Sachverzeichnis
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Читать дальше