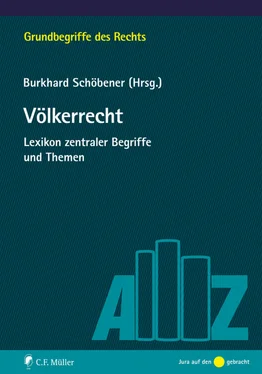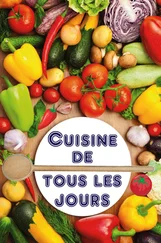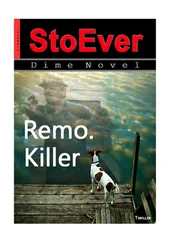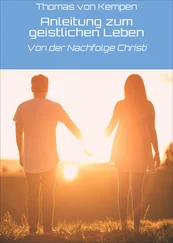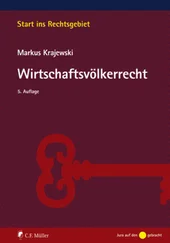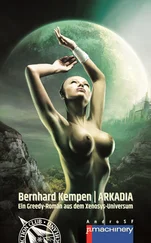1. Vorgaben zur friedlichen Streitbeilegung
Die ersten Versuche, Krieg als Mittel der Politik im Völkerrecht zu untersagen, betrafen nur die Rechtsfragen eines völkerrechtlichen Verbots und hatten durchgreifende Mängel ( → Kriegsrecht, ius ad bellum ); die Strafbarkeit eines solchen Verstoßes wurde hingegen nicht normiert.
2. Verbrechen gegen den Frieden im IMG- und IMGFO-Statut
Das wegen des Verstoßes gegen das strafrechtliche Rückwirkungsverbot und als einseitiges Siegerdiktat kritisierte IMG-Statut vom 8.8.1945 normierte erstmals in der Geschichte des Völkerrechts die Strafbarkeit eines „Verbrechens gegen den Frieden“. Nach Art. 6a IMG-Statut wurde das Planen bzw. die Vorbereitung und Einleitung oder Durchführung eines Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung internationaler Verträge, Abkommen oder Zusicherungen oder die Beteiligungen an einem gemeinsamen Plan oder an einer Verschwörung zur Ausführung einer der vorgenannten Handlungen unter Strafe gestellt. Zur völkerrechtlichen Zielvorstellung, Kriege zu verhüten, führte Robert H. Jackson, Richter am US Supreme Court und Chefankläger von Nürnberg, am 21.11.1945 in seinem Eröffnungsplädoyer aus: „Aber der letzte Schritt, periodisch wiederkehrende Kriege zu verhüten, die bei internationaler Gesetzlosigkeit unvermeidlich sind, ist, die Staatsmänner vor dem Gesetz verantwortlich zu machen. (…) Dieses Gesetz wird zwar hier zunächst nur auf deutsche Angreifer angewandt, es schließt aber ein und muss, wenn es von Nutzen sein soll, den Angriff jeder anderen Nation verdammen, nicht ausgenommen die, die jetzt hier zu Gericht sitzen.“ Mit dem IMG-Statut und ebenso mit Art. 5a des IMGFO-Statuts und dem KRG 10 ( → Völkerstrafrecht) wurde der Angriffskrieg als völkerrechtswidriger Krieg verboten.
3. Vorgaben der UN-Charta
Heute gilt völkerrechtlich auf der Ge- und Verbotsebene das sog. „universelle“ → Gewaltverbotgem. Art. 2 Ziff. 4 der Charta der → Vereinten Nationen(UN-Charta, Sart. II, Nr. 1), das militärische Gewaltanwendung oder ihre Androhung in den zwischenstaatlichen Beziehungen verbietet. Zur Strafbarkeit eines Verstoßes gegen das universelle Gewaltverbot äußert sich die UN-Charta nicht. Sie unterscheidet begrifflich allerdings zwischen einem „Aggressionsakt“ (act of aggression), der in Art. 39 UN-Ch. einer Bedrohung (threat to the peace) oder einem Bruch des Friedens (breach of the peace) gleichgestellt wird, und ermöglicht, dass der UN-Sicherheitsrat Kapitel VII-Maßnahmen nach Art. 41 ff. UN-Ch. ergreift ( → System kollektiver Sicherheit), und dem grundsätzlich unabhängig vom Sicherheitsrat bestehenden naturgegebenen Recht der Staaten zur individuellen und kollektiven → Selbstverteidigung, das in Art. 51 UN-Ch. anerkannt, aber nur durch einen „bewaffneten Angriff“ (armed attack) ausgelöst wird.
4. GA-Res 3314 (XXIX) vom 14.12.1974
Nach langen Diskussionen und Verhandlungen bezüglich einer Definition des Begriffs „bewaffneter Angriff“ konnte sich die → Generalversammlungder Vereinten Nationen am 14.12.1974 in ihrer Aggressions-Resolution (Sart. II, Nr. 5) lediglich auf eine Bestimmung des Begriffs der „Angriffshandlung“ (act of aggression), nicht jedoch auf eine Definition des Begriffs „bewaffneter Angriff“ (armed attack) einigen, wobei diese Resolution der Generalversammlung ohnehin nur eine Empfehlung, aber kein bindendes Recht und außerdem ein politisches Statement darstellt, das den Sicherheitsrat bei seinen Entscheidungen nach Kapitel VII der UN-Charta unterstützen sollte, aber nicht als materielle strafrechtliche Regelung konzipiert war oder dienen sollte. Die Begriffe „bewaffneter Angriff“ einerseits sowie „Angriffshandlung“ andererseits werden in der Charta in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt, werden nicht als identisch angesehen und entsprechen sich mithin inhaltlich definitionsgemäß nicht. So gelten bei einem „bewaffneten Angriff“ strengere Voraussetzungen als bei einer „Angriffshandlung“. Demnach ist eine verbotene Gewaltanwendung eines Staates, die noch unterhalb der Schwelle des bewaffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-Ch. bleibt, eine solche, die den bedrohten Staat noch nicht ermächtigt, von seinem Recht auf bewaffnete Selbstverteidigung Gebrauch zu machen, gleichwohl aber nach Art. 8 bis ein Aggressionsverbrechen darstellen kann. Inkonsequent ist auch der Inhalt des Art. 3 der GA-Resolution 3314: Die Tatbestände des Art. 3 lit. a – d können tatsächlich als Beispiele für eine „armed attack“ angesehen werden. Demgegenüber stellten die Tatbestände des Art. 3 lit. e – g eher Beispiele für einen „act of aggression“ dar.
5. Römisches Statut vom 17.7.1998
Da sich die von den Vereinten Nationen einberufene Staatenkonferenz, die vom 16.6. – 17.7.1998 in Rom tagte und am 17.7.1998 das Statut verabschiedete, noch nicht auf die Formulierung des Tatbestandes der Aggression einigen konnte, wurde in Art. 5 Abs. 2 bestimmt, dass der Gerichtshof die Gerichtsbarkeit über das Verbrechen der Aggression ausübt, sobald in Übereinstimmung mit den Artikeln 121 und 123 – also auf Änderungsvorschlag eines Vertragsstaates nach Art. 121 Abs. 1 oder durch die Versammlung der Vertragsstaaten (Art. 112 ff.) auf einer Überprüfungskonferenz frühestens sieben Jahre nach Inkrafttreten des Statuts (1.7.2002) mit Zweidrittel-Mehrheit (Art. 121 Abs. 3) – eine Bestimmung angenommen worden ist, die das Verbrechen definiert und die Bedingungen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Hinblick auf dieses Verbrechen festlegt.
6. Kampala-Überprüfungskonferenz
Auf der ersten Überprüfungskonferenz des Römischen Statuts in Kampala, Uganda, vom 31.5. – 11.6.2010 konnte die Versammlung der Vertragsstaaten erst in allerletzter Minute (tatsächlich war bereits der 12.6.2010 angebrochen) einen Konsens zur Formulierung des Tatbestandes der Aggression (künftig Art. 8 bis ) und seiner Verbrechenselemente (künftig Art. 15 bis und ter ) erzielen. Im Streit stand nicht so sehr die Aggressionsdefinition selbst, sondern die Frage, ob das Tätigwerden des IStGH vom Vorliegen der Feststellung eines Aggressionsaktes durch den UN-Sicherheitsrat (sog. Sicherheitsratsfilter) abhängen sollte oder nicht. Die USA, Rußland und China wollten als Nicht-Vertragsstaaten zunächst jede Einigung zum Tatbestand der Aggression verhindern, später schwenkten sie auf die von Frankreich und Großbritannien favorisierte Sicherheitsratsfilter-Lösung um. Afrikanische und lateinamerikanische Staaten standen dieser Option ablehnend gegenüber, Europa konnte wegen der britischen und französischen Haltung keine einheitliche Linie finden. Christian Wenaweser, Diplomat aus Liechtenstein, der schon in der jahrelang vor Kampala tätigen Vorbereitungsgruppe erreicht hatte, dass die Definition des Aggressionstatbestandes nicht mehr streitig war, hat mit seinem taktischen Geschick in den frühen Morgenstunden des 12.6.2010 das nicht mehr für möglich gehaltene, völkerrechtspolitisch sicher sehr wichtige Ziel erreicht, dass die nunmehr vorliegende Vertragsänderung des Römischen Statuts im Consensus-Verfahren angenommen wurde. Diese neuen Regelungen treten aber frühestens 2017 in Kraft.
Nach dem in Kampala im Consensus-Verfahren einstimmig beschlossenen künftigen Art. 8 bis ist das Verbrechen der Aggression von einer Doppelnatur gekennzeichnet, die auf einer Makroebene den völkerrechtswidrigen Akt einer kollektiven, staatlichen Aggression („act of aggression“ – Abs. 2) und auf einer Mikroebene das individuelle Aggressionsverbrechen („crime of aggression“ – Abs. 1) umfasst. Das Vorliegen einer gegen das Völkerrecht verstoßenden staatlichen Aggressionshandlung hat demnach nicht automatisch die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit der an einer solchen Handlung beteiligten Personen zur Folge; diese ist vielmehr gesondert festzustellen, was man bei dem Verfahren vor dem IMG in Nürnberg noch nicht erkannt hatte. Ferner führt Art. 8 bis Abs. 1 zusätzlich eine sog. Schwellenklausel ein, nach der nicht jeder staatliche Aggressionsakt, sondern nur solche einer bestimmten Qualität zur Strafbarkeit eines Aggressionsaktes führen (ebenfalls Abs. 1).
Читать дальше