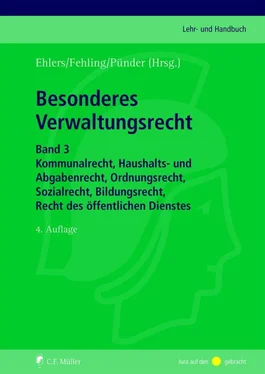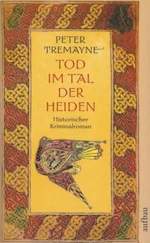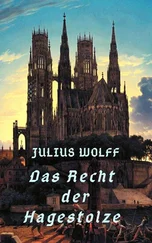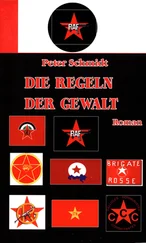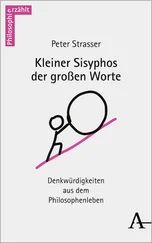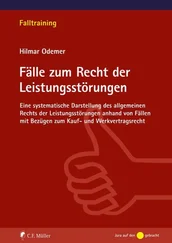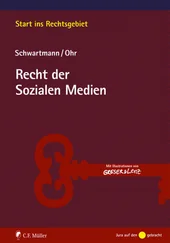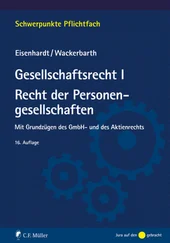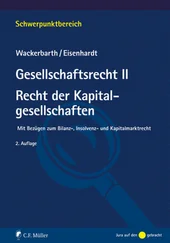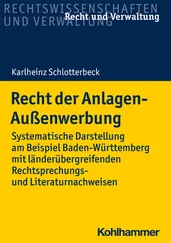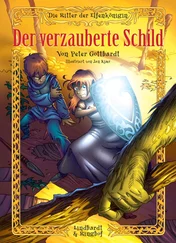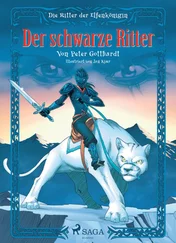Peter Bülow - Recht der Kreditsicherheiten
Здесь есть возможность читать онлайн «Peter Bülow - Recht der Kreditsicherheiten» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Recht der Kreditsicherheiten
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Recht der Kreditsicherheiten: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Recht der Kreditsicherheiten»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Recht der Kreditsicherheiten — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Recht der Kreditsicherheiten», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
91
Bei Personalsicherheitenfindet der Forderungsübergang kraft Gesetzes statt, nämlich bei der Bürgschaft nach § 774 BGB (unten Rn. 930) und beim Schuldbeitritt nach § 426 Abs. 2 BGB (unten Rn. 1737), nicht jedoch bei der Garantie (unten Rn. 1688).
92
(2) Lässt es der Sicherungsgeber, sei er mit dem Schuldner identisch oder sei er Interzessionar, auf die Verwertung ankommen, sind die Rechtsverhältnisse bei den gesetzlichen Realsicherheiten bis ins Einzelne ausgeformt (unten Rn. 452, 633, 754), bei den Personalsicherheiten liegen sie in der Inanspruchnahme des Interzessionars (unten Rn. 1145, 1766). Die Verwertung kautelarischer und damit nicht-akzessorischer (oben Rn. 43) Realsicherheiten richtet sich nach dem Sicherungsvertrag; danach hat der Sicherungsnehmer diejenige Verwertungsart auszuwählen, welche den bestmöglichen Erlös verspricht. Er hat also eine Prognose über die Erlösaussichten anzustellen (unten Rn. 1320). Demgemäß kann der freihändige Verkauf, die Versteigerung (unten Rn. 1317), aber auch der Selbsteintritt (unten Rn. 1324) geboten sein. Ein Mehrerlös, der den Anspruch des Gläubigers übersteigt, ist dem Sicherungsgeber als Partei des Sicherungsvertrages zu erstatten (unten Rn. 1311); dieser wird zum Gläubiger einer Geldforderung gegen den Sicherungsnehmer. Die vollständige Befriedigung des Gläubigers als Maß des Verwertungsverfahrens prägt auch die Regelung von § 818 ZPO, wonach eine Zwangsversteigerung einzustellen ist, sobald der Erlös zur Befriedigung hinreicht (BGH NJW 2007, 1276 Tz. 15 mit Anm. G. Vollkommer S. 1278).
VIII. Gang der Darstellung
93
Um zu verstehen, aus welchen Gründen die Kautelarpraxis von gesetzlichen Kreditsicherungstypen abweicht, muss man diese gesetzlichen Typen kennen. Im ersten Kapitel sind deshalb die gesetzlichen Kreditsicherungstypen dargestellt, im zweiten Kapitel kautelarische Kreditsicherheiten. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Darstellung und der Lösung der Fragen, die sich stellen, wenn mehrere Sicherungsnehmer auf dieselbe Kreditsicherheit zugreifen wollen.
1. Kapitel Die gesetzlichen Kreditsicherungstypen
1. Kapitel Die gesetzlichen Kreditsicherungstypen
94
Sicherungsmittel für einen Kredit können bewegliche und unbewegliche Sachen sein, Rechte und Personen. Für die Kreditsicherung durch eine Person stellt das Gesetz die Bürgschaft als Typus zur Verfügung. An Sachen und Rechten kann der Gläubiger dadurch gesichert werden, dass ihm die Befugnis übertragen wird, Sache oder Recht zu verwerten und sich aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Darin verkörpert sich der Typus des Pfandrechts. Im Falle des Kaufs beweglicher Sachen kann sich der Verkäufer im Hinblick auf den noch nicht erbrachten Kaufpreis dadurch sichern, dass trotz Übergabe der Sache der Eigentumserwerb des Käufers nicht eintritt: Hierin liegt der gesetzliche Typus des Eigentumsvorbehalts.
Inhaltsverzeichnis
1. Abschnitt Pfandrechte
2. Abschnitt Einfacher Eigentumsvorbehalt
3. Abschnitt Personalsicherheiten
1. Kapitel Die gesetzlichen Kreditsicherungstypen› 1. Abschnitt Pfandrechte
1. Abschnitt Pfandrechte
95
Nach dem Gegenstand, auf dem das Pfandrecht lastet, unterscheidet das Gesetz Grundpfandrechte, Pfandrechte an beweglichen Sachen und Pfandrechte an Rechten.
1. Kapitel Die gesetzlichen Kreditsicherungstypen› 1. Abschnitt Pfandrechte› I. Wesensmerkmale
A. Abschlussfreiheit und zwingendes Recht
96
Sollen nach dem Willen der Parteien des Sicherungsgeschäfts, Sicherungsgeber (der auch Interzessionar sein kann, oben Rn. 20) und Sicherungsnehmer, bewegliche oder unbewegliche Sachen oder Rechte (z.B. Forderungen) den Kredit sichern, stellt das Gesetz die Pfandrechte als Kreditsicherungstypen zur Verfügung. Die Ausformung der Rechtsbeziehungen unter den Beteiligten einer Pfandrechtsbestellung ist durch den gesetzlichen Typus in den meisten Einzelheiten zwingend vorgegeben, und der Privatautonomie sind Grenzen gesetzt: Zwar ist die Frage, ob das Pfandrecht überhaupt bestellt werden soll, den Parteien überlassen, aber weitgehend nicht die Frage, wie es ausgestaltet ist. Haben die Parteien ein Pfandrecht erst einmal bestellt, müssen sie sich dem gesetzlichen Muster unterwerfen, auch wenn es ihren wirtschaftlichen Bedürfnissen, Vorstellungen und Wünschen nicht entsprechen sollte. Schon hier ist der Ursprung für Überlegungen der Parteien gelegt, wie sie Rechtsgegenstände als Kreditsicherungsmittel nutzbar machen können, ohne den Typus des Pfandrechts zu wählen (oben Rn. 28) – Privatautonomie ist ja gerade nicht begrenzt, solange es um den Vertragsschluss selbst geht.
1. Dogmatische Begründung des Pfandrechts
97
Das Ziel des Pfandrechts liegt in der Verwertung des Gegenstandes und der Befriedigung des Gläubigers aus dem Verwertungserlös, nachdem der Sicherungsfall (oben Rn. 74) eingetreten ist. Die Art der Verwertung steht dem Pfandgläubiger als Sicherungsnehmer nicht frei, sondern kann sich nur in den vom Gesetz zugelassenen Bahnen vollziehen, in erster Linie durch öffentliche Versteigerung (unten Rn. 452 ff., 640 ff., 756). Die Verwertung durch Veräußerung des verpfändeten, belasteten Gegenstands bleibt durch die Verpfändung unberührt, steht also nach wie vor dem verpfändenden Rechtsinhaber (Pfandschuldner) zu und ist Teil des umfassenden, durch § 903 BGB für den Fall einer Sache beschriebenen Herrschaftsrechts des Eigentümers, gleichermaßen des Inhabers einer Forderung oder eines anderen Rechts. Die Befugnis zur Verwertung durch Versteigerung wird dem Pfandgläubiger als Belastung des Rechtsgegenstands zugewiesen und ist ein beschränktes dingliches Recht daran. Es entsteht durch Verfügungsgeschäft zwischen Rechtsinhaber und Gläubiger, dem Pfandvertrag nach §§ 1205, 1273, 873 BGB. Der Rechtsinhaber selbst ist auf der anderen Seite zur Verwertung des Gegenstandes durch öffentliche Versteigerung nach §§ 1228 ff., 1277 resp. dem ZVG nicht befugt, weder nach noch ohne Verpfändung (unten Rn. 394). Der Pfandgläubiger erhält ein dingliches Recht der Art, wie es der Rechtsinhaber vorher nicht hatte und nicht erlangen kann. Dies unterscheidet das Pfandrecht vom Nießbrauch, wo dem Nießbraucher als beschränkt dinglich Berechtigtem die ausschließliche Nutzungsbefugnis an der Sache (§ 1030) oder am Recht (§ 1068) übertragen wird, die vorher dem Rechtsinhaber als Teil seines umfassenden Herrschaftsrechts zugewiesen war. Man kann im Falle des Pfandrechts folglich nicht mit Fug davon sprechen, dass aus der umfassenden Herrschaftsbefugnis des Inhabers ein Teil davon abgespalten würde[1]. Was der Inhaber nicht hat, kann er nicht abspalten; was er aber hat, nämlich die Verwertungsbefugnis im Wege der Veräußerung, behält er und spaltet es ebenfalls nicht ab.
Anmerkungen
[1]
So aber die Lehre von der Teilrechtsabspaltung, Baur/Stürner , § 3 B. (Rn. 23, S. 18); § 36 II. 2. a. (Rn. 62, S. 401); § 60 I. 2. (S. 610); s. auch Enneccerus/Nipperdey , § 79 A. I. 4. (S. 459); Schapp/Schur , Sachenrecht, Rn. 384, zur Theorie der Realobligation(der Eigentümer schulde die Geldsumme, hafte aber nur aus dem Grundstück) so jetzt noch Eickmann , in: Westermann, Sachenrecht, § 93, S. 686 und in MünchKomm. § 1147 BGB Rn. 4, sowie zur Theorie der dinglichen Schuld(der Haftung mit dem Grundstück entspreche eine persönliche Schuld des Eigentümers) s. die Darstellung bei Baur/Stürner , § 36 II. 2. a. dd. (Rn. 68, S. 400); die Gesetzesformulierungen in §§ 1113, 1192, 1199 sind wie diejenigen in § 1204 Abs. 1 zu verstehen (Befriedigung aus der Sache).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Recht der Kreditsicherheiten»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Recht der Kreditsicherheiten» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Recht der Kreditsicherheiten» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.