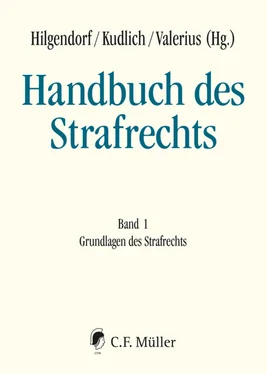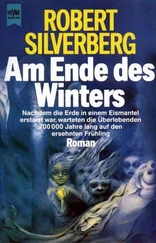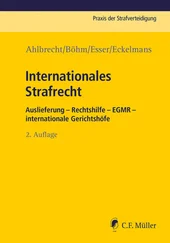2
Dennoch ist der Konkretisierungsbeitrag des Strafrichters reduziert, denn die dem Richter sonst bei der Rechtsarbeit üblichen Konkretisierungstechniken stehen ihm nicht in vollem Umfang und in derselben Freiheit zur Verfügung.[6] So ist ihm die analoge Anwendung von strafbarkeitsbegründenden bzw. strafbarkeitsschärfenden Normen durch Art. 103 Abs. 2 GG untersagt,[7] und man wird auch (noch) stärker als sonst unter den Auslegungsargumenten einen Vorrang normtextnaher Argumente und damit insbesondere der Verwendung im allgemeinen (Alltags-)Sprachgebrauch besondere Bedeutung zuzumessen haben.[8]
II. Der Konkretisierungsvorgang und die Auslegungsmetapher
3
Nach traditionellem Verständnis besteht die Auslegung von Gesetzen darin, dass der Normtext soweit „entfaltet“ (bzw. „ausgelegt“) wird, bis die in ihm gleichsam versteckte Lösung des Auslegungsproblems deutlich wird. Realistischer ist demgegenüber die Annahme, dass die Lösung des Problems noch nicht wirklich im Normtext (wie in einem Behälter voller Bedeutungen, unter denen die richtige nur herausgesucht werden muss) „steckt“. Vielmehr besteht in den Fällen, in denen eine Auslegung streitig ist, ein Bedeutungskonflikt zwischen den Beteiligten am Strafprozess,[9] und der Rechtsanwender hat den Konflikt über die Bedeutung des Normtextes tatsächlich selbst zu entscheiden . Er hat zwar das Gesetz, an das er nach Art 20 Abs. 3, 97 GG gebunden ist, als zentralen Orientierungspunkt. Auch dieses entbindet ihn jedoch nicht von der Last, letztlich eine eigene Entscheidung zu treffen.[10] Dieses unterschiedliche Verständnis vom tatsächlichen Vorgehen bei der Auslegung muss hier nicht vertieft werden – denn unabhängig davon gilt: Für die Entfaltung der oder aber die Entscheidung über die Bedeutung des Normtextes sind Hilfsmittel erforderlich. Diese Hilfsmittel sind zahlreich (und theoretisch sogar unbegrenzt), wobei die Diskussion üblicherweise durch die sog. Kanones der Auslegung geprägt ist, bei denen üblicherweise insbesondere zwischen grammatischer, systematischer, historischer und historisch-genetischer sowie teleologischer Auslegung unterschieden wird. Hinzu treten insbesondere die „Konformauslegungen“, also verfassungskonforme, konventionskonforme, richtlinienkonforme etc. Auslegung.
4
Wie „funktionieren“ nun diese Kanones bei der Entscheidung über den Bedeutungskonflikt? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich noch einmal den Ausgangspunkt der Überlegungen klar machen. Dieser ist die Frage, ob ein bestimmter tatsächlicher Fall vom Gesetz „gemeint“ ist, d.h. ob er „unter das Gesetz passt“ oder nicht. Ein Fall wird dann immer umso weniger „unter das Gesetz passen“, wenn der fragliche Begriff eng verstanden wird, d.h. wenn die mit ihm verbundenen Bedeutungsmöglichkeiten reduziert werden können. Umgekehrt wird der Fall umso eher von einem Gesetzestext erfasst sein, wenn der dort verwendete Begriff weit verstanden wird, d.h. wenn die mit ihm verbundenen Bedeutungsmöglichkeiten vermehrt werden. Mit anderen Worten: Kanones der Auslegung sind letztendlich Argumente für eine Vermehrung oder Reduzierung der Bedeutungsmöglichkeiten von gesetzlichen Begriffen, indem der Begriff in einen bestimmten Kontext gestellt wird. Bei der grammatischen Auslegung ist dies der Kontext des (insb. Alltags-)Sprachgebrauchs; bei der systematischen Auslegung der Kontext der Verwendung des Begriffs in anderen Vorschriften, usw.[11]
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung› § 3 Die Auslegung von Strafgesetzen› B. Die Auslegungsinstrumente
B. Die Auslegungsinstrumente
I. Die klassischen Kanones der Auslegung und ihre Anwendung im Strafrecht
5
Im Folgenden sollen zunächst die klassischen Kanones – insoweit nicht abweichend von allgemeinen methodentheoretischen Grundsätzen, aber jeweils illustriert an strafrechtlichen Beispielen – dargestellt werden, bevor weitere (nicht unbedingt weniger wichtige, aber weniger oft abstrakt benannte) Auslegungsargumente (vgl. Abschnitte II [ Rn. 46 ff.] und III [ Rn. 72 ff.]) untersucht werden und der Rangfolgenfrage nachgegangen wird (vgl. Abschnitt IV [ Rn. 100 ff.]). Zum klassischen Auslegungsquartett folgen einer kurzen Beschreibung des jeweiligen Inhalts der Methode[12] Erläuterungen nach, wie diese im o.g. Sinne bedeutungsreduzierend oder gerade bedeutungserweiternd wirken kann,[13] sowie eine Sammlung von Beispielen aus der Rechtsprechung; Sonderfragen der strafrechtlichen Auslegung, die in engem Bezug zu einer der klassischen Methoden stehen, werden jeweils im Zusammenhang damit exkursartig behandelt.
1. Grammatische Auslegung
a) Der Kontext des (natürlichen und/oder Fach-) Sprachgebrauchs
6
Die grammatische Auslegung erschließt den Kontext der Alltagssprache und des Sprachgebrauchs des Gesetzes; daneben kann insbesondere in Spezialregelungen für bestimmte Lebensbereiche auch der Fachsprachgebrauch der jeweiligen Gruppe eine Rolle spielen.[14] Dahinter steht der Gedanke, dass der Gesetzgeber einen Begriff im Zweifel so verwenden wird, wie er allgemein oder in Fachkreisen der geregelten Materie verwendet wird oder wie er ihn selbst an anderer Stelle im Gesetz verwendet. Dass dies aber nicht notwendig so sein muss, sondern dass vielmehr der Alltagssprachgebrauch im Einzelfall innerhalb des Adressatenkreises der Norm durchaus einmal ein weiteres Verständnis eines Begriffes zulässt als der Fachsprachgebrauch, zeigt deutlich eine Entscheidung des BGH vom 25. Oktober 2006,[15] in der es um die Frage ging, ob (nach einer alten, insoweit begrifflich auf „Tiere und Pflanzen“ abstellenden Fassung des BtMG) Pilze unter den Pflanzenbegriff des BtMG a.F. subsumiert werden können. Mit der naturwissenschaftlichen Klassifizierung der Pilze ist das nur schwer zu vereinbaren, da diese schon seit einiger Zeit in der Botanik (insbesondere mangels Photosynthese) nicht mehr den „Pflanzen“ zugerechnet werden. Der 1. Strafsenat macht hier aber überzeugend deutlich,[16] dass diese Klassifizierung in der Umgangssprache nicht selten durchbrochen wird und deswegen den Normadressaten das Strafbarkeitsrisiko durchaus bewusst gewesen ist.
7
Dabei kann es freilich nicht entscheidend darauf ankommen, dass man – so der Senat im Bemühen um eine plastische Begründung – „immerhin (…) Pilze auch gemeinhin beim Obst- und Gemüsehändler“ kauft;[17] Denn die Einzelhandelsinfrastruktur orientiert sich ersichtlich weder am fach- noch am alltagssprachlichen Pflanzenbegriff, sind doch viele „Obst- und Gemüsehändler“ heutzutage südländische Feinkostläden, in denen auch Schafskäse und Mozzarella erworben wird, während man in „Pflanzen- und Gartencentern“ oft weder Obst noch Gemüse, dafür aber häufig Zierfische und Nagetiere kaufen kann. Auch Handys, Unterwäsche und Rasierapparate werden nicht schon dadurch zu Genussmitteln, dass sie regelmäßig in den Filialen eines bekannten Kaffeerösters angeboten werden. Entscheidend ist vielmehr, dass die Subsumtion unter den „aus der Sicht des Normadressaten erkennbaren Wortsinn des Terminus ‚Pflanze‘“ möglich und für den Normadressaten „also jedenfalls das Risiko einer Strafbarkeit erkennbar“ war.[18] Dies belegt der BGH mit „Recherche im Internet, das jedermann zur Veröffentlichung eigener Texte zugänglich ist und das deshalb umfassende Auskunft über das gesamte Spektrum des aktuellen Sprachgebrauchs geben kann“.[19] Damit wird berücksichtigt, dass die semantische Prägung heutzutage längst nicht mehr vorwiegend vertikal verläuft, sondern sich radikal in Folge des „web 2.0“ horizontalisiert hat. Gerade zum (damaligen) Strafbarkeitsrisiko des Handels mit „Zauberpilzen“ hatte sich eine Experten- und Autoritätenkultur „von unten“ auf Seiten herausgebildet,[20] die für die Meinungsbildung und damit das Sprachverständnis bei Konsumenten und Liebhabern berauschender Pilze nicht unterschätzt werden kann.
Читать дальше