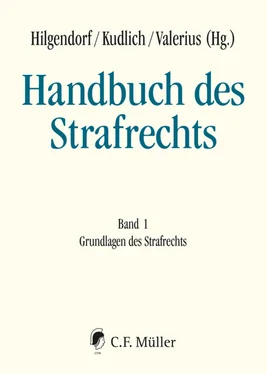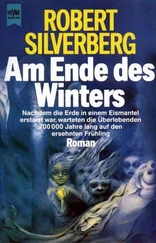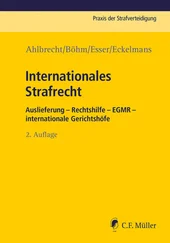[596]
Dazu Niemöller/Schuppert , AöR 107 (1982), 387, 405 ff.
[597]
So auch Hill , HStR Bd. VI, § 156 Rn. 81 f.
[598]
Vgl. H. Schmidt , Grundrechte als verfassungsunmittelbare Strafbefreiungsgründe, 2008, S. 24.
[599]
Vgl. BVerfGE 53, 152, 158; 59, 98, 103; 66, 199, 206; 72, 105, 115; 87, 399, 408 ff.; 93, 266, 292 f.
[600]
Vgl. BVerfGE 61, 1, 6; 66, 116, 131.
[601]
Niemöller/Schuppert , AöR 107 (1982), 387, 476; Hill , HStR Bd. VI, 2. Aufl. 2001, § 156 Rn. 87.
[602]
BVerfGE 126, 179, 199, 233; 130, 1, 44; BVerfG NJW 2013, 366 f.; siehe Rn. 40und Rn. 60.
[603]
Vgl. Hill , HStR Bd. VI, § 156 Rn. 85.
[604]
Vgl. BVerfGE 60, 313, 318; 86, 133, 147; 90, 22, 25; 119, 292, 297. Zur Problematik eingehend etwa Maunz/Dürig- Remmert , GG, 78. EL 2016, Art. 103 Rn. 106 ff.
[605]
Dies konstatiert auch Kudlich , JZ 2003, 127; siehe Rn. 15 ff.
[606]
Vgl. BVerfGE 27, 18, 30; 37, 201, 212; 45, 272, 289; 51, 60, 74; 80, 244, 255; 90, 145, 173.
[607]
Deutlich BVerfGE 90, 145, 173. Vgl. auch BVerfGE 25, 269, 286; 27, 18, 30; 37, 201, 212; 45, 272, 289; 51, 60, 74; 80, 244, 255; 88, 203, 258; siehe Rn. 30.
[608]
Klarsichtig Hesse , Mahrenholz-FS, S. 541, 542; Appel , Verfassung und Strafe, S. 96 f.
[609]
Ähnlich Kaspar , Verhältnismäßigkeit und Grundrechtschutz im Präventionsstrafrecht, 2014, S. 41 ff. Kritik an der Unschärfe des Verhältnismäßigkeitsprinzips äußert hingegen das Sondervotum von Mahrenholz in BVerfGE 86, 288, 346.
[610]
So zu Recht bereits Appel , Verfassung und Strafe, S. 34 ff.
[611]
Als paradigmatisch kann insoweit BGH, 6.4.2017, 3 StR 326/16, Rn. 29 ff., angesehen werden, wo die Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen überspannt werden.
[612]
So aber die Befürchtung von Arzt , Kaufmann-GS, 1989, S. 839, 847; Gössel , ZStW 2013 (1991), 483, 494 f.; ähnlich Naucke , KritVj 1993, 135, 162.
[613]
Vgl. etwa BVerfGE 41, 121, 124 f.; 45, 187, 253 f.; 50, 5, 9 f.; 73, 206, 237 ff., wo das Bundesverfassungsrecht jeweils keine strafrechtsdogmatische Position bezieht. Anders freilich BVerfGE 87, 399 ff. zum strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriff.
[614]
Deutlich BVerfGE 50, 5, 9 f.; vgl. auch Appel , Verfassung und Strafe, S. 104 ff.; anders Tiedemann , Verfassung und Strafrecht, 1991, S. 15 ff.
[615]
Zum Selbstand des Strafrechts etwa Meyer , Kleinknecht-FS, S. 267; Naucke , in: Lüderssen (Hrsg.), Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen das Böse?, Band 1, 1998, S. 156, 164 ff.; Roxin , Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 2. Aufl. 1973, S. 10 f.; Schünemann , 1. Roxin-FS, S. 1, 7 ff., Kritisch Gärditz , Der Staat 49 (2010), 331, 337 ff.
[616]
Gusy , StV 2002, 153, 154; wohl auch H. Schmidt , Grundrechte als verfassungsunmittelbare Strafbefreiungsgründe, 2008, S. 97 ff.
[617]
Möstl , HStR Bd. VIII, § 179 Rn. 51.
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung› § 3 Die Auslegung von Strafgesetzen
Hans Kudlich
§ 3 Die Auslegung von Strafgesetzen
A.Einführung: Auslegungsbedürftigkeit und Auslegungsvorgang1 – 4
I. Die Auslegungsbedürftigkeit – auch im Strafrecht1, 2
II. Der Konkretisierungsvorgang und die Auslegungsmetapher3, 4
B.Die Auslegungsinstrumente5 – 108
I. Die klassischen Kanones der Auslegung und ihre Anwendung im Strafrecht5 – 45
1.Grammatische Auslegung6 – 15
a) Der Kontext des (natürlichen und/oder Fach-) Sprachgebrauchs6 – 8
b) Verengung der Verständnismöglichkeiten9
c) Erweiterung der Verständnismöglichkeiten10
d) Beispiele aus der Rechtsprechung11
e) Exkurs: „Grammatische Auslegung“ und „Regeln der Grammatik“12 – 15
2.Systematische Auslegung16 – 29
a) Der Kontext der Begriffsverwendung an anderen Stellen und der Gesetzesstruktur16, 17
b) Verengung der Verständnismöglichkeiten18, 19
c) Erweiterung der Verständnismöglichkeiten20 – 22
d) Beispiele aus der Rechtsprechung23
e) Exkurs: Systematische Auslegung und Akzessorietät von Strafnormen zu außerstrafrechtlichen „Primärmaterien“24 – 29
3.Historische und historisch-genetische Auslegung30 – 36
a) Der Kontext von Vor- und Entstehungsgeschichte30, 31
b) Verengung der Verständnismöglichkeiten32, 33
c) Erweiterung der Verständnismöglichkeiten34, 35
d) Beispiele aus der Rechtsprechung36
4.Teleologische Auslegung37 – 45
a) Der Kontext des „wahren“ Gesetzeszweckes37, 38
b) Verengung der Verständnismöglichkeiten39 – 41
c) Erweiterung der Verständnismöglichkeiten42 – 44
d) Beispiele aus der Rechtsprechung45
II. Die „Konformauslegungen“ – Bedeutung, Arten und Abgrenzung46 – 71
1. Die verfassungskonforme Auslegung47 – 49
2.Die verfassungsorientierte Auslegung (diesseits „harter Verfassungswidrigkeit“)50 – 61
a) Einordnung: Strafrecht – Verfassung – Auslegung50, 51
b) Vorbehalte gegen die Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Überlegungen?52, 53
c)Die Wirkweise verfassungsorientierter Auslegung54 – 61
aa) Allgemeine Fragen54, 55
bb) Insbesondere die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes56 – 61
3.Weitere Arten der Konformauslegung bzw. der „vorrangorientierten Auslegung“62 – 71
a) Einordnung62, 63
b) Konformauslegung mit Blick auf die EMRK64, 65
c) Unionsrechtskonforme Auslegung66 – 71
III.Die strafrahmenorientierte Auslegung als strafrechtsspezifisches Auslegungskriterium „zweiter Stufe“72 – 99
1. Die Divergenz zwischen theoretischer Behandlung und praktischer Bedeutung einer „strafrahmenorientierten Auslegung“72
2. Zur Abgrenzung: Strafrahmenorientierung und allgemeine Folgenorientierung73, 74
3. Strafrahmenorientierung und klassisches Methodenquartett75 – 85
a) Verhältnis zur systematischen Auslegung76, 77
b) Verhältnis zur historisch-genetischen Auslegung78 – 81
c) Verhältnis zur teleologischen Auslegung82, 83
d) Zwischenergebnis84, 85
4. Inhaltliche Berechtigung einer strafrahmenorientierten Auslegung86 – 93
a) Die Strafrahmenberücksichtigung als Folge der allgemeinen Teleologie rechtlicher Regelungen88, 89
b) Das Verhältnis von Sanktionshöhe und Weite der Auslegung90, 91
c) Der Umgang mit Weite und partieller Inkonsistenz der Strafrahmen im StGB92, 93
5. Grenzen der strafrahmenorientierten Auslegung94 – 99
IV. Die Rangfolge der Auslegungsargumente100 – 108
C. Fazit109, 110
Ausgewählte Literatur
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung› § 3 Die Auslegung von Strafgesetzen› A. Einführung: Auslegungsbedürftigkeit und Auslegungsvorgang
A. Einführung: Auslegungsbedürftigkeit und Auslegungsvorgang
I. Die Auslegungsbedürftigkeit – auch im Strafrecht
1
Ebenso wie in allen anderen Rechtsgebieten ist auch im Strafrecht bei der Anwendung seiner Rechtsquellen – d.h. namentlich des StGB, aber auch der zahlreichen Gesetze mit flankierenden Strafvorschriften („Nebenstrafrecht“) und auch der Normen, welche für die Strafbarkeit in Bezug genommen werden[1] – eine Auslegung erforderlich. Das besondere, durch Art. 103 Abs. 2 GG auch verfassungsrechtlich widergespiegelte Interesse an Bestimmtheit und möglichst weitreichender Determination der Rechtsanwendung durch den Gesetzgeber[2] ändert daran nur bedingt etwas. Gewiss ist die besondere strukturelle Situation des strafenden Staates mit seiner erheblichen Eingriffsintensität zu berücksichtigen, da die verfassungsrechtliche Stellung des von der staatlichen Strafverfolgung betroffenen Bürgers sich auch methodisch widerspiegeln muss.[3] Dennoch zeigt die Geschichte, dass Versuche, die Anwendung des Rechts von vornherein – insbesondere durch Auslegungsverbote – festzulegen, gescheitert, ja eigentlich zum Scheitern verurteilt gewesen sind.[4] Die Bedeutungsgrenzen von Wörtern als solchen sind nicht nur unscharf, sondern können prinzipiell überhaupt nicht angegeben werden, da selbst umfassende Wörterbücher nur Verwendungsbeispiele aufzählen, nicht aber nach Art eines „Sprachgesetzbuches“ korrekte und inkorrekte Verwendungen dauerhaft und verbindlich festschreiben.[5] Jede Anwendung einer Regel pfropft diese auf einen neuen Kontext auf und verschiebt sie damit wenigstens minimal. Ein Verbot der Auslegung könnte also nur erfolgreich sein als Verbot der Anwendung eines Gesetzes.
Читать дальше