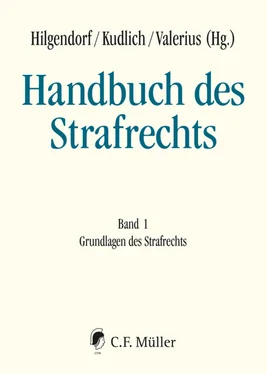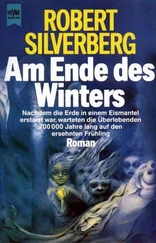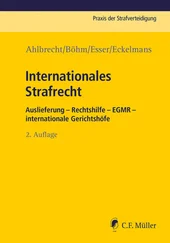[19]
W. Vogel , Die Religionsstifter, 2008.
[20]
Burns , Leadership, 1978; allgemein zum Führungsbegriff Kerschreiter/Frey , Art. „Führung“, in: Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, S. 132–136.
[21]
Der Begriff „Moralunternehmer“ oder „moralischer Unternehmer“ (moral entrepreneur) scheint erstmals von dem US-amerikanischen Soziologen Howard Saul Becker verwendet worden zu sein (Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, 1963).
[22]
Popitz , Soziale Normen, S. 62.
[23]
„So werden z.B. in jeder Kultur in einigen typischen, häufig wiederkehrenden Situationen verschiedenartige Verhaltensgebote an Männer und Frauen gestellt. Der Unterschied der Geschlechter kommt also auch in der Formulierung von Sozialnormen irgendwie zum Ausdruck. Vergleicht man jedoch die etwa den Frauen zugeschriebenen Sozialnormen in den uns bekannten Kulturen miteinander, so erweist es sich als äußerst schwierig, universal gültige Gemeinsamkeiten ‚wesenseigene‘ Verhaltenskonstanten zu finden. Der biologische Unterschied der Geschlechter ist im Hinblick auf das jeweils gebotene Verhalten offensichtlich nicht mehr als ein Startpunkt, ein Ansatzpunkt, von dem aus sich in jeder Kultur eine besondere Reihe von ‚Wesensunterschieden‘ entwickelt. Jede dieser kulturspezifischen Varianten erscheint uns, von außen gesehen, als mehr oder weniger willkürlich – oder besser: als künstlich.“ ( Popitz , Soziale Normen, S. 62).
[24]
Popitz , Soziale Normen, S. 62; ebenso schon Murdock , Social Structure, 1949, S. 284 ff.
[25]
Einführend Voland , Von der Ordnung ohne Recht zum Recht durch Ordnung. Die Entstehung von Rechtsnormen aus evolutionsbiologischer Sicht, in: Lampe (Hrsg.), Zur Entwicklung von Rechtsbewusstsein, 1997, S. 111–13; ausführlich ders ., Soziobiologie: Die Evolution von Kooperation und Konkurrenz, 4. Aufl. 2013; Bischof , Moral. Ihre Natur, ihre Dynamik und ihr Schatten, 2012. Aus soziologischer Sicht Esser , Soziologie. Allgemeine Grundlagen, 3. Aufl. 1999, S. 143–215. Kritisch zur Leistungsfähigkeit biologischer Ansätze für die Erklärung von Genese oder Inhalt sozialer Normen Rottleuthner , Foundations of Law, 2005, S. 70 ff.; vgl. auch dens ., Biologie und Recht, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1985, 104–126.
[26]
M. Weber , Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 1, S. 21; R. König , Das Recht im Zusammenhang der sozialen Normensysteme, 42. Sack , Probleme der Kriminalsoziologie, in: R. König (Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung, 2. Aufl. 1978 (Taschenbuchausgabe), Bd. 12, S. 369 betont die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Typen sozialer Normen.
[27]
Geiger , Vorstudien, S. 60.
[28]
Ebenda.
[29]
Ebenda. Der Sanktionsbegriff erfasst grundsätzlich positive wie negative Reaktionen, wird aber heute meist nur für negativ bewertende Reaktionen verwendet, vgl. Baer , Rechtssoziologie. Eine Einführung in die interdisziplinäre Rechtsforschung, 3. Aufl. 2016, § 9 Rn. 5 ff.; Lucke , „Norm und Sanktion“, in: Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, S. 338.
[30]
Deimling , Recht und Moral, S. 31.
[31]
v. Liszt , Lehrbuch, S. 27 f.
[32]
Geiger , Vorstudien, S. 82 f.
[33]
Popitz , Soziale Normen, S. 65. Hervorhebung i.O.
[34]
A.a.O., S. 66. Hervorhebung i.O.
[35]
Zum Rollenkonzept näher Schäfers , Einführung in die Soziologie, 2. Aufl. 2016, S. 76 ff.
[36]
A.a.O., S. 68.
[37]
A.a.O., S. 71.
[38]
A.a.O., S. 71. Zum damit angeschnittenen Themenfeld der „sozialen Kontrolle“ Schäfers , Einführung in die Soziologie, 2. Aufl. 2016, S. 81 ff.; Peukert , Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle, in: Korte/Schäfers (Hrsg.), Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie, 9. Aufl. 2016, S. 127 ff.
[39]
A.a.O., S. 73.
[40]
Ebenda.
[41]
Deimling , Recht und Moral, S. 31 f.
[42]
Sack , Probleme der Kriminalsoziologie, in: R. König (Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung, 2. Aufl. 1978 (Taschenbuchausgabe), Band 12, S. 370 schreibt, dass „der Typologie von Normensystemen auch eine analoge der Sanktionssysteme“ entspräche, „d.h. die Mittel und Mechanismen, derer sich Gesellschaften und andere soziale Gebilde zur Durchsetzung ihrer Verhaltenserwartungen an ihre Mitglieder bedienen, variieren mit dem Typ des Regelungssystems, das ein bestimmtes Verhalten verletzt“.
[43]
Ehrlich , Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), 4. Aufl. 1989, S. 146.
[44]
Ehrlich , Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), S. 146.
[45]
E. Ehrlich , Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), 4. Aufl. 1967, S. 146.
[46]
König , Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozess, 1985; siehe auch A. König , Mode, in: Endruweit/Trommsdorff/Burzan (Hrsg.), Wörterbuch der Soziologie, S. 325 ff.
[47]
Einen Überblick über diese weitgefasste, in besonderem Maße dem historischen Wandel unterworfene Kategorie gibt Göttert , Zeiten und Sitten. Eine Geschichte des Anstands, 2009.
[48]
Dazu schon von Jhering , Der Zweck im Recht, 1923, S. 45 f.
[49]
Acham , Struktur, Funktion und Genese von Institutionen aus sozialwissenschaftlicher Sicht, in: G. Melville (Hrsg.), Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde, 1992, S. 25 ff.
[50]
Kelsen , Allgemeine Theorie der Normen, 1979, S. 1; dem folgend etwa Mayer-Maly , Rechtsphilosophie, 2001, S. 17.
[51]
Peukert , in: Korte/Schäfers (Hrsg.), Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie, 9. Aufl. 2016, S. 128.
[52]
Ebenda; umfassend → AT Bd. 1: Johannes Kaspar , Grundlagen der Kriminologie, § 19 Rn. 12 ff.
[53]
Durkheim in: R. König (Hrsg.), Die Regeln der soziologischen Methode, 2. Aufl. 1965, S. 160.
[54]
Karsten/von Thiessen (Hrsg.), Normenkonkurrenz in historischer Perspektive, 2015.
[55]
Zu nennen sind hier vor allem die rechtfertigende Pflichtenkollision und der rechtfertigende Notstand, § 34 StGB, wobei der Anwendungsbereich der rechtfertigenden Pflichtenkollision auf die Kollision von Handlungspflichten beschränkt ist. Welche Pflichten kollidieren, ist bei den genannten Rechtfertigungsgründen nicht von vornherein festgelegt. Dagegen sind bei der Notwehr, § 32 StGB, die Kollision von Fremdschädigungsverbot und Recht auf Selbstschutz bereits im Normwortlaut festgeschrieben.
[56]
BGHSt 4, 3; Laubenthal/Baier GA 2000, 205; ausf. → AT Bd. 1: Brian Valerius , Strafrecht und Interkulturalität, § 25.
[57]
Frisch , Schroeder-FS, S. 11, 16 ff.
[58]
Dazu unten Rn. 115 ff.
[59]
Im Folgenden soll zwischen der Moral als einer besonderen Art sozialer Normen und der Ethik als Reflexion auf diese Normen unterschieden werden.
[60]
Geiger , Vorstudien, S. 251.
[61]
Geiger , Vorstudien, S. 254.
[62]
Geiger , Vorstudien, S. 254 f. Ähnlich schreibt er in Über Recht und Moral, 1979, S. 170: „ Genetisch gesehen besteht zwischen Recht und Moral ein enger Zusammenhang (. . .). Beide haben als Systeme regelmäßigen Verhaltens ihren gemeinsamen Ursprung in Gewohnheit, Brauch und Sitte. Insoweit kann man sagen, daß embryonale Moral und embryonales Recht in eins zusammenfallen. In einem primitiven Stadium wird das Gemeinschaftsleben durch gewohnte Verhaltensformen bestimmt, die zum einen von einem religiösen Tabu umgeben sind und zum anderen von der Umgebung gegen den einzelnen durchgesetzt werden. Eine sowohl innere wie auch äußere Motivation bewirkt in diesem Stadium die Aufrechterhaltung des hergebrachten Verhaltens. Danach setzt ein Polarisierungsprozeß ein, in dessen Verlauf sich Moral und Recht als zwei selbständige Systeme zunehmend voneinander entfernen.“
Читать дальше