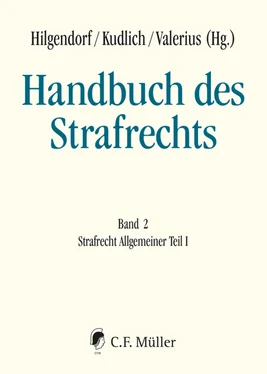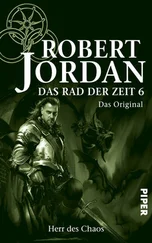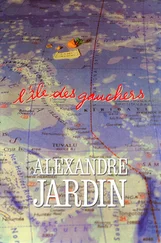100
Ein anderer Weg, die nationale Strafgewalt auszudehnen, um auch im Ausland vorgenommene Handlungen zu sanktionieren, die nach der eigenen Rechtsordnung als kriminell eingestuft werden, ist die Anknüpfung an Vorbereitungshandlungen im Inland. In jüngerer Zeit wurde dieses Verfahren etwa bei der Einführung der eigenständigen Strafvorschrift der Zwangsheirat in § 237 StGB angewandt, als in dessen Abs. 2 die sog. Heiratsverschleppung unter Strafe gestellt wurde, die der an sich zu bekämpfenden erzwungenen Eheschließung vorangeht. Die Zwangsheirat als solche findet aber nicht selten im Ausland statt, so dass hierauf die nationale Strafgewalt nicht ohne weiteres erstreckt werden kann (zur Heiratsverschleppung → AT Bd. 1: Brian Valerius , Strafrecht und Interkulturalität, § 25 Rn. 64).
101
Solche Entwicklungen sind nicht völlig unkritisch zu begleiten. Es gilt, die Grenzen der eigenen Staatsgewalt anzuerkennen und zu begreifen, dass der nationale Gesetzgeber allein ohnmächtig ist, um gegen die Formen des Straftatentourismus oder auch gegen Verhaltensweisen im Generellen wirkungsvoll vorzugehen, die nach hiesiger Werteordnung strafwürdig erscheinen. Hier die grundsätzlich zur Verfügung stehenden Wege wie nicht zuletzt eine Erweiterung des Katalogs des § 5 StGB überzustrapazieren, zeugt weniger von einer Lenkungsgewalt des Gesetzgebers, sondern beinhaltet eher eine Missachtung anderer staatlicher Souveräne und droht den völkerrechtlichen Nichteinmischungsgrundsatz zu verletzen. Im Ausland dürfte ein derartig einseitiges Vorgehen des Gesetzgebers auch zu Recht einen befremdlichen Eindruck ob des demonstrierten Selbstbewusstseins des Gesetzgebers hinterlassen, seine Werteordnung auch außerhalb des eigenen Territoriums mit Mitteln des Strafrechts schützen und verbreiten zu wollen.[238] Nationale Alleingänge sind somit grundsätzlich nicht empfehlenswert, wenn entsprechende Verhaltensweisen wirklich bekämpft werden sollen und nicht nur die eigene Bevölkerung durch ein vermeintlich entschlossenes Auftreten beruhigt werden soll. Vielfach werden hierfür nur diplomatische Mittel verbleiben, um für das eigene Verständnis zu werben und entsprechende völkerrechtliche bi- und multilaterale Vereinbarungenzu schließen. Dieser Weg ist zwar lang und beschwerlich und führt nicht einmal sicher zum Ziel, ist aber nationalen Alleingängen vorzuziehen.[239]
4. Strafanwendungsrecht als Kollisionsrecht?
102
In anderen Rechtsgebieten ist ein weitaus größeres Bemühen zu verzeichnen, internationale Sachverhalte nach einer einzigen Rechtsordnung zu regeln. So dient vor allem das Internationale Privatrechtdem Zweck, bei privatrechtlichen Sachverhalten mit Auslandsbezug aus mehreren denkbaren einschlägigen Rechtsordnungen diejenige auszuwählen, die allein anzuwenden bleibt.[240] Bei den entsprechenden Regelungen, die in Deutschland etwa in den Art. 3 ff. EGBGB zu finden sind, handelt es sich somit um echtes Kollisionsrecht.[241] Insoweit ist allerdings zu beachten, dass im Privatrecht bereits zahlreiche unionsrechtliche und staatsvertragliche Kollisionsnormen existieren, die – wie Art. 3 EGBGB ausdrücklich festhält – vorrangig heranzuziehen sind.[242]
103
Ebenso sind dem Öffentlichen RechtRegelungen nicht fremd, die Kollisionen der einzelnen Hoheitsgewalten auflösen wollen, indem bei grenzüberschreitenden Sachverhalten das Verhältnis der eigenen zu anderen staatlichen Rechtsordnungen bestimmt wird.[243] Jedoch scheint eine intensivere Diskussion über ein „internationales öffentliches Recht“ – freilich nicht verstanden als Völkerrecht, sondern als nationales Kollisionsrecht – bislang kaum geführt zu werden.[244]
104
Im Strafrechtbeschränken sich die nationalen Gesetzgeber im Wesentlichen gleichfalls darauf, die Reichweite der Strafgewalt auch auf grenzüberschreitende Sachverhalte einseitig zu bestimmen anstatt von vornherein Kollisionen durch entsprechende Regelungen zu vermeiden. Je weiter ein nationaler Gesetzgeber hierbei den Anwendungsbereich seiner Strafrechtsordnung im Allgemeinen zieht, desto wahrscheinlicher entstehen bei einer konkreten Tat Jurisdiktionskonflikte mit anderen Staaten. Allerdings muss ein extensives Strafanwendungsrecht nicht stets einem Bedürfnis des nationalen Gesetzgebers entspringen, sondern kann auch entsprechenden Vorgaben in völkerrechtlichen Regelungen geschuldet sein,[245] die (positive) Jurisdiktionskonflikte durch ein engmaschiges Netz nationaler Strafgewalten mehren wollen, damit gerade die Strafverfolgung von grenzüberschreitender Kriminalität gewährleistet wird.[246] Freilich ist die Ausgangslage bei Jurisdiktionskonflikten im Strafrecht gerade gegenüber dem Privatrecht zum einen insofern eine andere, als konkurrierende ausländische Regelungen ein Rechtsverhältnis widersprüchlich zu klären drohen, während bei konkurrierenden Strafgewalten in der Regel „nur“ eine Mehrfachsanktion droht, die ggf. noch auf anderem Wege vermieden werden könnte. Völlig ausgeschlossen scheint es allerdings nicht, dass widerstreitende nationale Rechtsordnungen den Normunterworfenen auch in ein Dilemma stürzen können, in dem sowohl ein aktives Tun nach der einen als auch dessen Unterlassen nach der anderen Rechtsordnung strafbar ist.[247] Zum anderen bliebe zu beachten, dass strafrechtliche Kollisionsregelungen nur die Voraussetzungen zum Gegenstand haben dürften, unter denen das eigene Recht angewendet werden kann; der unmittelbare Rückgriff nationaler Gerichte auf ausländische Strafvorschriften wird hingegen – anders als im Internationalen Privatrecht – bislang nicht diskutiert.[248]
105
Eine Ursache für die bisher gezeigte Zurückhaltung gegenüber strafrechtlichen Kollisionsregelungen mag darin liegen, dass gerade die nationale Strafgewalt eines Staates als ein Ausdruck der hoheitlichen Machtangesehen wird[249] und in diesem Bereich daher nur ungern Kompetenzen abgegeben werden. Ein ähnliches Bild lässt sich bei der Diskussion um ein Europäisches Strafrecht bemerken, bei der – losgelöst von sämtlichen Bedenken an der konkreten Entwicklung und an der unzureichenden Berücksichtigung zentraler Rechtsprinzipien bei den europäischen Einflüssen auf die nationale Strafrechtsordnung – im Allgemeinen Zurückhaltung bei der Übertragung von Zuständigkeiten an den Tag gelegt wird.
106
Solche durchaus nicht unberechtigten Bedenken einmal außer Acht gelassen, erweist sich im Strafrecht angesichts der wachsenden Zahl an Sachverhalten, in denen für ein und dasselbe Geschehen mehrere Staaten ihre Strafgewalt beanspruchen können, eine Abstimmung der Kompetenzbereiche indessen als zunehmend überlegenswert. Insoweit wird auch vermehrt auf das sog. Kompetenzverteilungsprinzipverwiesen, wonach die Staaten durch völkerrechtliche Vereinbarungen (insbesondere positive) Jurisdiktionskonflikte möglichst vermeiden und Doppelbestrafungen verhindern sollen.[250] Ob es sich hierbei allerdings um ein völkerrechtliches Prinzip und nicht nur um die Beschreibung eines berechtigten Anliegens und wünschenswerten Ziels handelt, erscheint fraglich. Zum einen vermag die Feststellung der fraglosen Notwendigkeit einer Konfliktlösung bei konkurrierenden Strafgewalten nicht die Diskussion um die hierfür erforderlichen Abgrenzungskriterien zu ersetzen.[251] Diese Kriterien dürfen zudem den völkerrechtlichen Charakter des Strafanwendungsrechts nicht außer Acht lassen.[252] Bereits geschlossene völkerrechtliche Verträge als Quelle heranzuziehen, drohte zum anderen bloße Zweckmäßigkeitsüberlegungen, auf denen Kompetenzabgrenzungen in den getroffenen Vereinbarungen beruhen, zu einem originären Prinzip zu überhöhen.[253]
107
In nach wie vor häufiger Ermangelung völkerrechtlicher Vereinbarungen[254] erscheint auch eine Rangfolge der Anknüpfungspunktefür die nationalen Strafgewalten diskussionswürdig. So schlägt Ambos – grob skizziert[255] – vor, grundsätzlich dem Territorialitätsprinzip den generellen Vorrang einzuräumen, wobei die Anknüpfung an den Handlungsort gegenüber dem Erfolgsort vorgehe.[256] Gleichrangig sei aber grundsätzlich das Realprinzip einzustufen, während subsidiär in absteigender Reihenfolge das aktive Personalitätsprinzip, das passive Personalitätsprinzip und schließlich allenfalls ergänzend der Grundsatz stellvertretender Strafrechtspflege einzuordnen seien.[257] Das Weltrechtsprinzip sei gegenüber Territorialitäts- und Personalitätsprinzipien subsidiär, wenn der Territorialstaat zur Strafverfolgung willens und fähig sei.[258] Nicht von der Hand zu weisen sind freilich Bedenken im Hinblick auf die Relativität und die Interdependenz der einzelnen Anknüpfungspunkte. Es erscheint daher bei jedem Versuch einer Hierarchisierung der völkerrechtlichen Prinzipien zum Strafanwendungsrecht fraglich, ob ihm mehr als lediglich ein Programmcharakter zukommt.[259]
Читать дальше