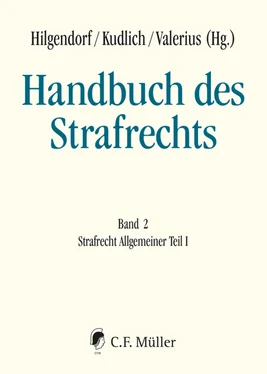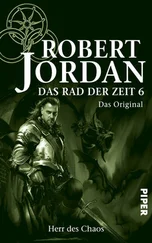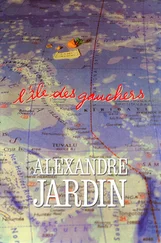2. Grenzüberschreitende Kooperation
93
Bei der Bestimmung der Reichweite der nationalen Strafgewalt kann auch die zunehmende grenzüberschreitende berufliche Zusammenarbeit Schwierigkeiten bereiten. Nicht zuletzt Forschungsvorhaben werden inzwischen häufig international betrieben und können insbesondere dann Strafbarkeitsrisiken für sämtliche Beteiligtebegründen, wenn sie ein (zumeist ethisch wie auch) rechtlich in der Staatengemeinschaft umstrittenes Projekt zum Gegenstand haben. Exemplarisch kann insoweit auf die Forschung an embryonalen Stammzellen verwiesen werden, die nach derzeitigem Stand der Wissenschaft nur durch die Abtötung von Embryonen gewonnen werden können und deren Gewinnung (sowie die darauf aufbauende Forschung) demzufolge in den einzelnen Staaten äußerst unterschiedlich geregelt ist. Das Spektrum reicht von den Extremen der uneingeschränkten rechtlichen Gestattung solcher Forschungsvorhaben (z.B. in Großbritannien und in den Niederlanden) einerseits und einem völligen Verbot (z.B. in Polen und Italien) andererseits bis hin zur eingeschränkten Zulässigkeit (wie in Deutschland unter den Voraussetzungen der §§ 4 f. StZG).
94
Sofern sich an solchen grenzüberschreitenden Projekten verschiedene Personen von verschiedenen Staaten aus beteiligen, sind auch die ggf. unterschiedlichen nationalen rechtlichen Regelungen einschließlich etwaiger Straftatbestände im Blick zu behalten. Da das Strafanwendungsrecht jedenfalls in Deutschland keine Kollisionsregelung enthält und das begrenzende „lex loci“-Erfordernis nur in § 7 StGB aufgenommen wurde, können sich insbesondere von Deutschland ausan dem Projekt teilnehmende Personen in der Regel nicht darauf berufen, dass ggf. in einem anderen Staat die rechtliche Zulässigkeit des Projekts außer Frage steht, selbst wenn es dort hauptsächlich betrieben wird. In diesem Fall begründet bereits die eigene Mitwirkung an dem jeweiligen Vorhaben von Deutschland aus hierzulande einen Handlungsort gemäß § 9 Abs. 1 Var. 1 StGB für Täter bzw. gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 Var. 2 StGB für Teilnehmer, so dass eine Inlandstat gegeben und somit deutsches Strafrecht unabhängig von der Rechtslage am Hauptort des Projekts anwendbar ist. Für den Teilnehmer regelt § 9 Abs. 2 S. 2 StGB sogar ausdrücklich, dass für die Teilnahme an einer Auslandstat vom Inland aus das deutsche Strafrecht gilt, auch wenn die Tat nach dem Recht des Tatorts nicht mit Strafe bedroht ist.
95
Bei Auslandstaten sind vor allem bei Forschungsvorhaben zudem § 5 Nr. 12 und 13 StGB zu beachten, sofern es sich bei dem Wissenschaftler um einen Amtsträgeroder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten handelt. Dies betrifft vor allem verbeamtete Wissenschaftler an staatlichen Universitäten. Hingegen sind Forscher an privaten Hochschulen oder auch an Max-Planck-Instituten bei gleicher wissenschaftlicher Tätigkeit wegen ihrer fehlenden Verbeamtung nicht erfasst.
96
Die vorstehenden Strafbarkeitsrisiken betreffen allerdings nicht nur Forscher im Inland, sondern auch Projektbeteiligte, die allein im Auslandtätig werden. Einen etwaigen Erfolgsort ebenfalls einmal nur im Ausland unterstellt, wäre auf ihre Forschungsbeiträge wegen ihres eigenen lediglich ausländischen Tätigkeitsortes das deutsche Strafrecht in der Regel an sich nicht anwendbar. Etwas anderes ergibt sich allerdings wegen der nach herrschender Meinung weitgehenden Zurechnung von Begehungsorten zwischen den einzelnen Beteiligten ( Rn. 81 ff.). Sollte an einem vollständig im Ausland stattfindenden und dort rechtlich zulässigen Projekt jemand aus Deutschland als (Mit-)Täter mitwirken und hierzulande das Vorhaben strafrechtlich untersagt sein, würde den Beteiligten im Ausland der Tätigkeitsort ihres (Mit-)Täters zugerechnet werden. Für die im Ausland tätigen Forscher läge somit gleichfalls eine Inlandstat vor und wäre deutsches Strafrecht anwendbar, und zwar unabhängig davon, ob das Gesamtvorhaben im Ausland straflos ist. Ebenso würde im Ausland tätigen Teilnehmern der Tätigkeitsort des hierzulande aktiven (Mit-)Täters über § 9 Abs. 2 S. 1 Var. 1 StGB zugerechnet werden.[233] Ein solches Ergebnis erscheint durchaus fragwürdig. Schließlich besteht der einzige Anknüpfungspunkt für die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts auf die im Ausland tätigen Wissenschaftler in der Mitwirkung einer Person von Deutschland aus. Unberücksichtigt bleibt hingegen völlig, dass sie sich regelkonform mit den Vorschriften ihres Aufenthaltsstaates verhalten, in dem das Projekt maßgeblich betrieben wird.
97
Angesichts der mittlerweile alltäglichen grenzüberschreitenden Kommunikation und der gestiegenen Mobilität erscheint eine an staatliche Grenzen gebundene Hoheitsgewalt schon fast als Anachronismus. Der einzelne Staat ist nahezu machtlos und vermag selbst mit Strafvorschriften das Verhalten seiner Bevölkerung nicht zu steuern, wenn es jedem ohne Weiteres möglich ist, sich in einen insoweit liberaleren Staat zu begeben und dort die hierzulande strafbare Tat im Einklang mit der dortigen Rechtsordnung zu begehen. Beispiele für ein solches Verhalten werden bereits praktiziert und sind nicht nur rein theoretischer Natur. So werden Spätabtreibungen in den Niederlanden vorgenommen, die einen Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Voraussetzungen noch bis zur 22. Schwangerschaftswoche und nicht „nur“ bis zur 12. Schwangerschaftswoche wie in Deutschland zulassen.[234] Die Rede ist diesbezüglich von einem „ Abtreibungstourismus“.[235] Eine ähnliche Situation ist im Bereich der Sterbehilfe im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Tätigkeit von Sterbehilfegesellschaften vorzufinden. Der hier praktizierte „ Sterbetourismus“ dürfte nach der Einführung des zum 10. Dezember 2015 in Kraft getretenen § 217 StGB durch das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung vom 3. Dezember 2015[236] voraussichtlich weiter zunehmen.
98
Unterschiedliche (straf)rechtliche Regelungen in den einzelnen Staaten lassen sich auch bei dem Umgang mit Äußerungen nicht zuletzt in den Kommunikationsdiensten des Internetsbemerken. Das Spektrum der zu bekämpfenden Inhalte reicht insoweit von ehrverletzenden Kundgaben oder sonstige Persönlichkeitsrechte des Betroffenen beeinträchtigenden Veröffentlichungen (z.B. die unbefugte Publikation von Nacktbildern) bis hin zu links- wie rechtsextremistischer Propaganda und kinderpornographischen Dateien. Aufgezeigt am Beispiel des Umgangs mit rechtsextremistischen Äußerungen sind insoweit in Deutschland anlässlich seiner leidvollen Geschichte restriktive Regelungen zu verzeichnen, welche die Auseinandersetzung mit volksverhetzenden und ähnlichen Erklärungen dem Strafrecht überlassen und nicht nur der gesellschaftlichen Diskussion überantworten wollen. Wer sich hiesigen rechtlichen Konsequenzen entziehen will, begibt sich ggf. in einen ausländischen Staat, der z.B. die Leugnung des Holocaust oder die Verbreitung von Symbolen des NS-Regimes nicht unter Strafe stellt, um von dort aus – etwa über die Kommunikationsdienste des Internets – entsprechende Inhalte auch nach Deutschland zu verbreiten.[237]
99
Fraglich ist, wie ein Staat auf solche Formen des „Straftatentourismus“ mit seinen beschränkten, grundsätzlich auf das eigene Territorium bezogenen Möglichkeiten reagieren soll. Auf rein nationaler Ebene stehen dem Gesetzgeber im Wesentlichen grundsätzlich zwei gangbare Wege zur Verfügung. Zum einen ist denkbar und wird in letzter Zeit auch zunehmend praktiziert ( Rn. 53), die Staatsgewalt auf bestimmte Auslandstaten auszudehnen, indem die entsprechenden Strafvorschriften in den Katalog des § 5 StGBaufgenommen werden.
Читать дальше