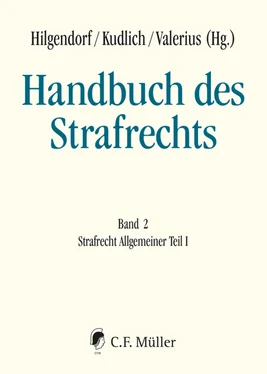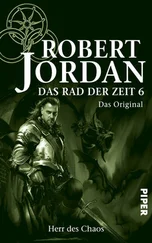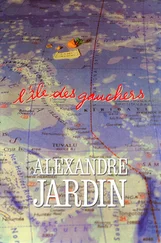83
Problematisch erscheint gleichfalls die in § 9 Abs. 2 S. 1 StGB angeordnete Zurechnung von Begehungsorten des Täters gegenüber dem Teilnehmer. Nach § 9 Abs. 2 S. 1 Var. 1 StGB ist die Teilnahme unter anderem „an dem Ort begangen, an dem die Tat begangen ist“. Über diese Regelung werden dem Teilnehmer sämtliche Begehungsorte sämtlicher (insbesondere Mit-)Täter als eigene zugerechnet. Dies führt – was unter anderem bei grenzüberschreitenden (ethisch wie) rechtlich umstrittenen Forschungsprojekten Strafbarkeitsrisiken hervorruft ( Rn. 93 ff.) – zu einer nicht unbedenklichen Vervielfältigung von Teilnahmeorten.[203] Dass diese gesetzliche Regelung nicht zu überzeugen vermag, verdeutlicht ein Vergleich mit der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts bei der Einheitstäterschaft im Fahrlässigkeitsbereich. Sollte im Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz ein Täter von Deutschland aus vorsätzlich einen Grenzbeamten in der Schweiz mit einer Waffe verletzen, die ihm in Kenntnis des Tatplans in Österreich ausgeliehen wurde, würde sowohl auf Täter (§ 9 Abs. 1 Var. 1 StGB) als auch auf Teilnehmer (§ 9 Abs. 2 Var. 1 StGB) das deutsche Strafrecht anwendbar sein. Fehlt hingegen sowohl Täter als auch Teilnehmer der Vorsatz im Hinblick auf eine Verletzung des Grenzbeamten, weil sie ihn durch den Schuss etwa nur erschrecken, nicht aber etwa treffen wollen, wäre zwar für den Schützen gemäß § 9 Abs. 1 Var. 1 StGB nach wie vor deutsches Strafrecht anwendbar. Für die fahrlässige Körperverletzung durch denjenigen, der dem Schützen die Waffe in Kenntnis des nicht ungefährlichen Tatplans verleiht, könnte hingegen für den Tätigkeitsort wegen seiner täterschaftlichen Haftung im Fahrlässigkeitsbereich nur auf dessen eigenen sorgfaltspflichtwidrigen Beitrag abgestellt werden, der indessen in Österreich erbracht wurde. Ob dieses unterschiedliche Ergebnis nur mit dem lediglich fahrlässigen statt vorsätzlichen Verhalten begründet werden kann, dürfte zu bezweifeln sein. Es spricht daher viel dafür, generell bei Tätern und Teilnehmern nur auf den eigenen Tätigkeitsort (sowie den in der Regel gemeinsamen Erfolgsort) abzustellen und von einer Zurechnung der Tätigkeitsorte abzusehen.
3. Irrtümer über das Strafanwendungsrecht
84
Welche Rechtsfolgen Fehlvorstellungen über den räumlichen Geltungsbereich nach sich ziehen, hängt maßgeblich von der Natur der Regelungen der §§ 3 bis 7, 9 StGB ab. Die herrschende Meinung ordnet die strafanwendungsrechtlichen Voraussetzungen als objektive Bedingungen der Strafbarkeitein.[204] Schließlich sei es eine völkerrechtliche Frage, wie weit die nationale Strafgewalt reicht. Die Antwort hierauf könne nicht in das Belieben eines Einzelnen gestellt werden oder von dessen Vorstellungen abhängen, sondern sei nach objektiven Kriterien zu bestimmen.[205] Fehlvorstellungen über die Voraussetzungen der §§ 3 bis 7, 9 StGB, z.B. über den Begehungsort der Tat (§ 9 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB) oder über die Staatsangehörigkeit des Opfers (§ 7 Abs. 1 StGB), sollen demnach zumindest keinen Tatumstandsirrtum begründen.[206]
85
Selbst auf dem Boden der herrschenden Ansicht bleiben Irrtümer über den räumlichen Geltungsbereich indessen nicht stets völlig unbeachtlich. Denn die Einordnung der Voraussetzungen des Strafanwendungsrechts als objektive Bedingungen der Strafbarkeit bedeutet nicht, dass ihnen kein Unrechtsgehalt zuteilwird.[207] Vielmehr bleibt zu berücksichtigen, dass sich die Beurteilung eines Verhaltens als Unrecht erst auf der Grundlage einer spezifischen Rechtsordnung ergibt. Auch die konkrete verletzte Rechtsordnung stellt somit einen eigenen Bezugspunkt für einen Irrtum dar.[208] In eine ähnliche Richtung argumentiert der BGH, wonach – aufgezeigt an dem Schutz der inländischen Strafrechtspflege durch den Tatbestand der Strafvereitelung gemäß § 258 StGB – einem Verbotsirrtum unterliege, wer die vom verwirklichten Straftatbestand umfasste spezifische Rechtsgutsverletzung nicht als Unrecht erkenne.[209] Fehlvorstellungen über die Anwendbarkeit einer Strafrechtsordnung können demzufolge einen Verbotsirrtumnach sich ziehen.[210]
III. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen
1. Reichweite des nationalen Strafrechts im Internet
86
Ein ungeklärtes Problem bildet nach wie vor die Anwendbarkeit des nationalen Strafrechts auf Straftaten im Internet. Für Straftaten, die mittels des Internetsbegangen werden, d.h. Rechner und Computernetzwerke als Tatmittel einsetzen, sind zunächst die allgemeinen Grundsätze heranzuziehen. Der Tätigkeitsort gemäß § 9 Abs. 1 Var. 1 StGB liegt demzufolge am Ort der auf die Tatbestandsverwirklichung gerichteten Handlung ( Rn. 71), d.h. dort, wo der Täter an seinem netzwerkfähigen Gerät sitzt und Befehle etc. über das Internet sendet. Der Erfolgsort im Sinne des § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB bleibt dort zu verorten, wo die von der jeweiligen Strafvorschrift erfassten Auswirkungen eintreten ( Rn. 72), häufig somit an dem Ort, an dem sich der Zielrechner befindet, der im Rahmen der Tat angesprochen wird. Wer sich also beispielsweise von Kanada aus unbefugten Zugriff auf einen Zielrechner in Portugal verschafft, begeht eine entsprechende Straftat sowohl in Kanada als auch in Portugal. Wer von den Niederlanden aus Lebenserhaltungssysteme in einem Krankenhaus in Japan manipuliert und dadurch den Tod eines Patienten hervorruft, begeht die Tat sowohl in den Niederlanden als auch in Japan. Es versteht sich von selbst, dass die zur Illustration genannten Staaten beliebig gewählt und ohne Verlust einer inhaltlichen Aussage auch durch allgemeine Platzhalter A, B, C etc. ersetzt werden können.
87
Denkbar erscheint, ebenso das Strafrecht derjenigen Staaten anzuwenden, über deren Territorium die via Internet verbreiteten Befehle, Daten etc. befördert werden. Einer solchen Lösung steht aber bereits das praktische Element entgegen, dass der Nachweis des konkreten Datenweges mit enormen Schwierigkeiten verbunden wäre, vor allem die dezentrale Struktur des Internets mit seinen Routern zur Folge hat, dass selbst Teile ein und derselben transferierten Datei über verschiedene Wege vom Ausgangs- zum Zielrechner gesendet werden können. Insbesondere lassen sich hier jedoch die Überlegungen zum Transitdeliktübertragen, wonach allein die Beförderung von Tatobjekten oder Tatmitteln grundsätzlich noch nicht die Ausübung der nationalen Strafgewalt legitimiert ( Rn. 78). Demzufolge begründet allein die Versendung von Daten über das Territorium eines Staates noch nicht die Anwendbarkeit dessen Strafrechtsordnung.
88
Während somit auf Straftaten mittels des Internets die allgemeinen Grundsätze zum Strafanwendungsrecht ohne weiteres übertragen werden können, bereiten Straftaten im Internet, d.h. rechtswidrige Veröffentlichungen in dessen mannigfaltigen Kommunikationsdiensten, nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Aufgrund der dezentralen Struktur und zugleich fehlenden Abhängigkeit des Internets von staatlichen Grenzen können Inhalte, die jemand von seinem Rechner in einem bestimmten Staat aus im Internet (z.B. auf Webseiten, in Meinungsforen oder auf Plattformen sog. sozialer Netzwerke) ohne Zugangsbeschränkung veröffentlicht, grundsätzlich weltweit abgerufen werden. Äußerungen im Internet ist folglich gemein, die Hoheitsgewalt und das Territorium zahlreicher, in der Regel sogar sämtlicher Staaten der Welt zu betreffen; insoweit kann von einem sog. multiterritorialen Delikt ( Rn. 77) gesprochen werden. Bereits den Abruf oder sogar die bloße Abrufbarkeit solcher Daten in einem Staat ausreichen zu lassen, damit dessen Strafrecht Anwendung findet, führte jedoch dazu, dass sich jegliche frei im Internet veröffentlichte Äußerung an den Strafrechtsordnungen sämtlicher Staaten der Welt messen lassen müsste. Es würden letztlich somit die jeweils restriktivsten nationalen Strafgesetze über die Strafbarkeit von Inhalten im Internet entscheiden.[211]
Читать дальше