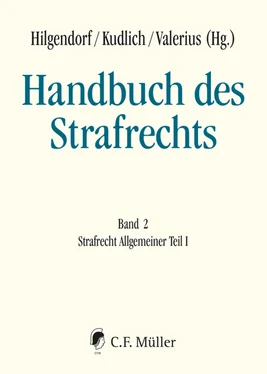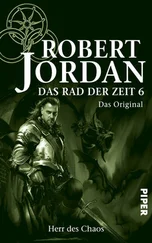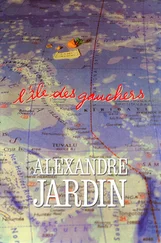38
Es lässt sich festhalten, dass nicht zuletzt wegen der stetig wachsenden Kataloge der §§ 5, 6 StGB das Territorialitäts- als Ausgangsprinzip des deutschen Strafanwendungsrechts zahlreiche Ergänzungenbei Auslandstaten erfährt. Sowohl die Entwicklung im Allgemeinen als auch einzelne Vorschriften sind im Hinblick auf den völkerrechtlichen Nichteinmischungsgrundsatz nicht unkritisch zu begleiten.[78]
2. Inlandstaten
a) § 3 StGB: Territorialitätsprinzip
39
§ 3 StGB leitet den Normenkomplex zum Strafanwendungsrecht mit der Regelung ein, dass das deutsche Strafrecht für Taten gilt, die im Inland begangen werden. Damit wird das völkerrechtliche Territorialitätsprinzip als maßgebliches Kriterium für die Reichweite der deutschen Strafgewalt herangezogen. Was zum „ Inland“ im Sinne der Vorschrift gehört, wird ebenso unter Heranziehung der völkerrechtlichen Überlegungen zur Ausdehnung des Staatsgebiets ermittelt.[79] Inzwischen[80] ergeben sich somit keine Unterschiede zwischen der deutschen Rechtslage und dem völker- und staatsrechtlichen Inlandsbegriff.[81]
40
Unter Tat im Sinne des § 3 StGB soll nach herrschender Meinung – ebenso wie bei § 4 und § 7 StGB – die Tat im prozessualen Sinnezu verstehen sein.[82] Ob es sich bei einer Tat um eine Auslands- oder um eine Inlandstat handelt, wird somit stets für das gesamte Verhalten des Täters entscheiden, das mit den in der Anklage umschriebenen Vorkommnissen nach natürlicher Auffassung einen einheitlichen Vorgang darstellt.[83] Schließlich gelte es gerade solche Lebenssachverhalte strafrechtlich (nach deutschem Recht) zu bewerten.[84] Dem wird entgegengehalten, dass die Bestimmung des Begehungsortes gemäß § 9 Abs. 1 StGB und somit auch die Einordnung eines Geschehens als Inlandstat stets den jeweiligen Straftatbestand in den Blick nehmen muss und demzufolge für jeden einzelnen Straftatbestand getrennt zu erfolgen hat.[85]
41
Unstreitig bleibt hingegen im Rahmen der §§ 5, 6 StGB auf die Tat im materiellrechtlichen Sinneabzustellen. Bei diesen Vorschriften orientiert sich der Umfang des räumlichen Geltungsbereichs gerade an einzelnen Straftatbeständen.[86] Die Erstreckung der nationalen Strafgewalt knüpft hier an die jeweiligen Schutzgüter der einzelnen Vorschriften und nicht an einen Lebenssachverhalt in seiner Gesamtheit an.[87]
b) § 9 StGB: Ubiquitätsprinzip
42
Welche Taten als Inlandstaten einzuordnen sind, richtet sich nach deren Begehungsort. § 9 StGB greift hierbei auf das Ubiquitätsprinzipzurück und zieht als Begehungsort sowohl den Handlungs- als auch den Erfolgsort heran. In Anlehnung an die deutsche Beteiligungsdogmatik enthält § 9 Abs. 1 StGB eine Regelung für Täter ( Rn. 43 ff.) und § 9 Abs. 2 StGB eine ähnlich aufgebaute Regelung für Teilnehmer ( Rn. 46 ff.). Für die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts genügt es, dass nur einer der ggf. zahlreichen Tatorte sich im Inland befindet.[88]
bb) Begehungsort der Tat (§ 9 Abs. 1 StGB)
43
Nach § 9 Abs. 1 StGB ist eine Tat zunächst „an jedem Ort begangen, an dem der Täter gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte handeln müssen.“ Mit diesen beiden ersten Varianten wird das Tätigkeitsprinzipaufgegriffen und zugleich die deutsche Unterscheidung zwischen den beiden Begehungsmodalitäten des aktiven Tuns und des Unterlassens (zum Begehungsort bei Unterlassungstaten Rn. 73) berücksichtigt. Zur Zurechnung von Begehungsorten bei Mittäterschaft und bei mittelbarer Täterschaft Rn. 81 f.
44
Ein weiterer Begehungsort liegt gemäß § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB an jedem Ort, an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist. Diese Regelung greift das Erfolgsprinzipauf, aus dessen Zusammenspiel mit dem Tätigkeitsprinzip das Ubiquitätsprinzip erwächst. Umstritten ist nicht zuletzt die Anwendbarkeit der Vorschrift bei abstrakten Gefährdungsdelikten ( Rn. 74 f.).
45
§ 9 Abs. 1 Var. 4 StGB bestimmt einen Begehungsort der Tat schließlich an jedem Ort, an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg „nach der Vorstellung des Täterseintreten sollte“. Diese Regelung erscheint allerdings dann als kritikwürdig, wenn der Täter einem Irrtum über den Erfolgsort unterliegt und sein Verhalten entgegen seiner Vorstellung überhaupt keine Auswirkungen auf dem Territorium des betreffenden Staates entfalten kann. Allein die Absicht, einen zum Tatbestand gehörenden Erfolg im Inland zu bewirken, erscheint nicht als ausreichender Anknüpfungspunkt.[89]
cc) Begehungsort der Teilnahme (§ 9 Abs. 2 StGB)
46
§ 9 Abs. 2 StGB bestimmt den Begehungsort für die Teilnahme. Die eigenständige Regelung lehnt sich in ihrem Satz 1 an § 9 Abs. 1 StGB an, indem ebenso diejenigen Orte herangezogen werden, an denen der Teilnehmer gehandelt hat (vgl. § 9 Abs. 1 Var. 1 StGB) oder im Fall des Unterlassens hätte handeln müssen (vgl. § 9 Abs. 1 Var. 2 StGB) oder an denen nach der Vorstellung des Teilnehmers die Tat begangen werden sollte (vgl. § 9 Abs. 1 Var. 4 StGB). An die Stelle des Erfolgsorts gemäß § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB tritt der – in § 9 Abs. 2 StGB zuerst genannte – Ort, an dem die Tat begangen ist; der Begehungsort der Tat bildet somit gewissermaßen den Erfolgsort der Teilnahme.[90] Dies hat jedoch zur Folge, sämtliche vier möglichen Begehungsorte des § 9 Abs. 1 StGB ebenso als Begehungsorte der Teilnahme anzusehen. Mitunter werden daher bis zu zehn verschiedene Begehungsorteder Teilnahme gezählt.[91]
47
Die nicht unerhebliche Vielzahl von Begehungsorten des Teilnehmers und die damit einhergehende Reichweite der nationalen Strafgewalt erfährt keine weitere Einschränkung. Dies wäre vor allem dann zu erwägen, wenn die Begehungsorte in verschiedenen Staaten liegen und daher mehrere nationale Rechtsordnungen mit unterschiedlichen Rechtsfolgen und ggf. sogar Strafbarkeiten anwendbar sind. Stattdessen sieht § 9 Abs. 2 S. 2 StGBausdrücklich vor, dass das Tatortrecht selbst bei Straflosigkeit der Tat keine Berücksichtigung findet, wenn der Teilnehmer an einer Auslandstat im Inland gehandelt hat. Für diese weite Regelung werden unter anderem generalpräventive Gesichtspunkte und der Gedanke der Gleichbehandlung angeführt; schließlich sollen sämtliche Teilnahmehandlungen im Inland dieselben strafrechtlichen Folgen nach sich ziehen.[92] Ob solche Überlegungen es indessen rechtfertigen, die Teilnahme an einem im Ausland straflosen Verhalten unter Strafe zu stellen, erscheint fraglich, wird die strafrechtliche Beurteilung des Tatortstaats dadurch jedenfalls bewusst nicht beachtet.[93]
3. Auslandstaten
a) § 4 StGB: Flaggenprinzip
48
§ 4 StGB setzt das Flaggenprinzipin deutsches Recht um. Danach gilt auch für Taten, die auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen werden, deutsches Strafrecht, sofern das jeweilige Fortbewegungsmittel berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. Wer sich auf ein solches Fahrzeug begibt, soll durch das deutsche Strafrecht geschützt werden, unabhängig sowohl von dem Standort des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Tat als auch von dem Verfolgungswillen des Territorialstaats.[94] Unerheblich ist, ob sich das Fahrzeug bereits fortbewegt oder noch bzw. schon wieder zum Halt gekommen ist.[95] Ebenso wenig kommt es auf die Staatsangehörigkeit von Täter und Opfer an.
49
Dass mit § 4 StGB keine Erweiterung des Staatsgebiets einhergeht, sondern lediglich ein inländischer Tatort fingiert wird („gilt“),[96] verdeutlicht der Verweis auf die Unbeachtlichkeit des Tatortrechts. Befindet sich der Tatort ohnehin nach den §§ 3, 9 StGB im Inland, kommt § 4 StGB keine gesonderte Bedeutung zu und wird überwiegend § 3 StGB als vorrangige Regelung angesehen.[97]
Читать дальше