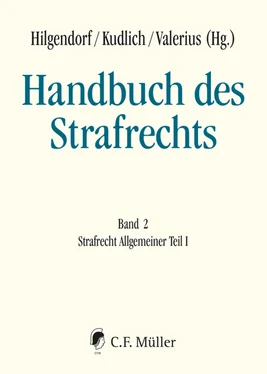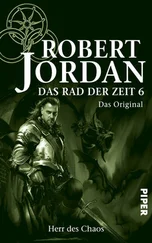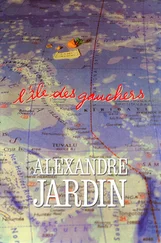28
Das verdeutlicht ohne detaillierten Rekurs auf einzelne Fallgruppen und Beispiele[96] auch schon die bekannte „allgemeinen Grundformel“ zur objektiven Zurechnung, wonach ein Erfolg dann zurechenbar sein soll, wenn eine missbilligte Gefahr geschaffen worden ist und sich diese Gefahr im Erfolgseintritt realisiert (sowie der Erfolgseintritt auch in den Schutzzweck der verletzten Verhaltensnorm fällt):[97] Denn ob die Handlung eine Gefahr (die von dem Erfolg, in dem sich die Gefahr erst verwirklichen muss, zu unterscheiden ist) schafft oder erhöht und insbesondere ob diese Gefahr schaffung eine unerlaubte ist, hängt noch nicht mit dem Erfolg (sunrecht) und seiner Zurechnung i.e.S. zusammen, sondern betrifft noch die Frage nach einer Qualifizierung des Verhaltens als tatbestandsmäßiges und damit den Unwertgehalt der Handlung .[98] Das wird vielleicht sogar noch deutlicher, wenn man mit Schünemann für die Prüfung der objektiven Zurechnung danach fragt, ob die Einhaltung der tatbestandlichen Verhaltensnorm ex ante und ex post betrachtet zur Schadensverhütung sinnvoll gewesen wäre.[99] Denn die (insbesondere ex-ante‑) Eignung zur Schadensverhütung ist allein eine Eigenschaft des Verhaltens und damit der – im Falle der Nichteinhaltung – tatbestandsmäßigen (oder eben nicht tatbestandsmäßigen) Handlung, nicht des deliktischen Erfolges. Entscheidend zur Bestimmung des Handlungsunrechts ist dabei die Frage, ob der Täter ein pflichtwidriges Risiko für das geschützte Rechtsgut geschaffen hat.
29
Gegen die Figur der „objektiven Zurechnung“ sowie die damit zusammenhängende Betonung der Pflichtwidrigkeit und somit für eine stärkere Betonung des subjektiven Tatbestandes sprechen sich auch bis in die Gegenwart verschiedene Kritiker aus.[100] Die dabei insbesondere von Kindhäuser ebenso detailliert wie scharfsinnig geübte Kritik muss hier aus Gründen des Umfangs auf zwei zentrale Aspekte reduziert werden, die einer Stellungnahme bedürfen, wenn man die Berechtigung dieser Figur im Folgenden zugrunde legen will:
30
Zum einen sieht Kindhäuser – explizit auch mit Auswirkung für die Bestimmung des Handlungsunrechts – für das Vorsatzdelikt „kein(en) Raum mehr (…), soll nicht auf Tatbestandsebene die Zurechnung kraft Täterwissen in einem überflüssigen Doppelschritt vollzogen werden.“[101] Eine der subjektiven Zurechnung vorgeschaltete „Zurechnung zur Handlungsfähigkeit eines fiktiven Normadressaten“ sei dysfunktional, da entweder beide „Filter“ identische Wirkung auf unterschiedlichen Prüfungsstufen hätten oder aber sogar der „frühere Filter“ etwas „stoppt (…), was den späteren Filter passieren darf und soll“.[102]
31
Daran ist ohne Zweifel richtig, dass die Trennung zwischen objektiver Zurechnung und der Berücksichtigung subjektiver Elemente nicht so klar und scharf vollzogen werden kann, wie es die Terminologie vielleicht glauben macht. Dies wird etwa bei der Berücksichtigung von Sonderkenntnissen des Täters deutlich, die haftungsbegründend wirken können, wenn ein ganz unwahrscheinlicher „objektiv nicht bezweckbarer“ Geschehensablauf vorliegt, den der Täter individuell aber vorhersehen kann.[103] Allerdings sind zum einen nicht alle Fallgruppen der objektiven Zurechnung so „gestrickt“; vielmehr sind etwa im Rahmen des erlaubten Risikos[104] bzw. durch entsprechende Sondernormen auch explizite „Verletzungserlaubnisse“ vorstellbar.[105] Zum anderen bietet es eine zwar gewiss nicht unverzichtbare,[106] aber dennoch wertungsmäßig interessante Feststellung, ob die fehlende Zurechnung auf individuellen Defekten des Täters oder bereits auf dem objektiven Fehlen einer unerlaubten Gefahrschaffung beruht. Die (weniger schlimme Alternative der) Dysfunktionalität dahingehend, dass „zwei Filter“ mit gleicher Wirkung auf verschiedenen Stufen angebracht werden, wird dadurch wettgemacht, dass der Filter nicht nur (im Prüfungsschema und damit in der Begriffsbildung) früher, sondern auch dort angebracht wird, wo er inhaltlich hingehört.
32
Zum anderen sei die Vorsatzhaftung auch unabhängig von der Feststellung von Sorgfaltswidrigkeiten, was Kindhäuser mit einem Beispiel zu verdeutlichen sucht: Analysiere man das „Verbot der Brandstiftung durch unsorgfältigen Umgang mit Streichhölzern“, sei offensichtlich die Eigenschaft „‚unsorgfältig‘ nicht verbotskonstitutiv, wenn man das merkwürdige Ergebnis vermeiden will, daß Brandstiftung durch sorgfältigen Umgang mit Streichhölzern erlaubt sei“.[107] Freilich wird dieses Ergebnis weniger „merkwürdig“, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es hier letztlich um einen (bewusst oder unbewusst) abweichenden Begriff der „Sorgfaltswidrigkeit“ geht. Während Kindhäuser in seinem Beispiel die sorgfältige (und damit nicht sorgfalts widrige ) i.S.d. genau überlegten Benutzung der Streichhölzer in den Mittelpunkt rückt (die beim Anzünden eines Hauses in gleicher Weise vorliegen kann wie beim Anzünden der Kerze an einem Adventskranz), wäre nach tradiertem Verständnis die (Sorgfalts‑)Pflichtverletzung bei der vorsätzlichen Brandstiftung in der Verwendung der Streichhölzer im konkreten sozialen Kontext zu sehen. Das vorsätzliche Entzünden eines fremden Hauses kann daher ohne weiteres „sorgfältig“ vorgenommen werden, ohne dass das Verhalten deswegen pflichtgemäß wäre.
3. Konstitutive Handlungsunrechtselemente beim Vorsatzdelikt – zum Wechselspiel von Intentionsunrecht und objektiven Handlungsunrechtselementen
33
Sollen nun die objektiven Handlungsunrechtskomponenten beim Vorsatzdelikt näher umschrieben werden, so scheint sich bereits mit der Benennung einer „pflichtwidrigen Risikoschaffung“ als Voraussetzung eines auch „objektiven“ Handlungsunrechts, aber auch auf Grund der vorangegangenen Ausführungen schon terminologisch die Frage aufzudrängen, ob hier nicht letztlich aus der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bekannte Elemente auch zur Konturierung der Vorsatzstrafbarkeit herangezogen werden können bzw. sogar müssen oder aber ob die Anforderungen an die objektive Pflichtwidrigkeit des Verhaltens – da beim Vorsatzdelikt eben nur einen Teil des Handlungsunrechts ausmachend – niedriger anzusetzen sind:
a) „Fahrlässigkeit“ als Voraussetzung jedes Vorsatzdelikts?
34
Die extremste und voraussetzungsvollste Position ließe sich damit beschreiben, dass auch beim Vorsatzdelikt das Handlungsunrecht in identischer Weise begründet werden muss wie beim Fahrlässigkeitsdelikt, bei dem nach seit langem einhelliger Auffassung die Pflichtwidrigkeit auch als objektives Verhaltensmoment erforderlich ist,[108] um den Unrechtstatbestand zu begründen. Eine Gleichschaltung des Handlungsunrechts bei Fahrlässigkeits- und Vorsatzdelikt würde nun dadurch erreicht, dass – wie insbesondere von Herzberg immer wieder pointiert gefordert wird – „Fahrlässigkeit (sc. zur) Voraussetzung jeder Vorsatzhaftung“ gemacht würde, d.h. dass keine Strafbarkeit wegen eines Vorsatzdeliktes bejaht werden könnte, wenn der Täter durch das gleiche Verhalten – den Vorsatz hinweggedacht – nicht auch ein Fahrlässigkeitsdelikt begangen hätte.[109] Ganz ähnlich klingt das etwa[110] auch bei Jakobs , wenn er feststellt, dass „eine (. . .) sorgfaltsgemäße Vorsatztat (. . .) eine contradictio in adiecto“ wäre,[111] und schon 35 Jahre früher bei Krauß , der meint, dass „niemand wegen einer vorsätzlichen Tat bestraft werden kann, der nicht auch ohne Vorsatz bei entsprechender Strafdrohung wegen fahrlässiger Begehung bestraft würde.“[112]
35
Читать дальше