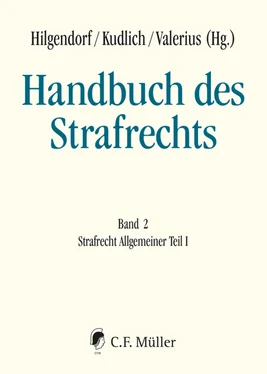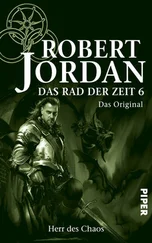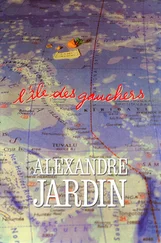42
Für die Frage nach der Missbilligung des Verhaltens bei vorsätzlicher Erfolgsherbeiführung und damit nach der Bestimmung des Handlungsunrechts führt dies zu folgendem Ergebnis: Das Handlungsunrecht des Vorsatzdelikts wird durch objektive Elemente der Art und Weise des Verhaltens sowie durch subjektive Elemente [130] und dabei insbesondere den Vorsatz geprägt. Dabei sind auch beim Vorsatzdelikt die objektiven Komponenten nicht generell oder vollständig durch vorhandene (und vielleicht sogar besonders stark ausgeprägte) subjektive Komponenten ersetzbar. Ein Verzicht auf jegliches objektives Handlungsunrecht alleine wegen des Vorliegens von Vorsatz würde nicht nur der h.L., die entsprechende Zurechnungskorrektive anerkennt, widersprechen und dem durch die unterschiedlichen Strafrahmen verdeutlichten Unrechtsgefälle zum Fahrlässigkeitsdelikt nicht gerecht werden. Vielmehr würden auch ganz unterschiedlich gefährliche, mittelbare oder unmittelbare, nahezu sichere und ganz unwahrscheinliche Verletzungshandlungen über einen Kamm geschoren, wenn nur ein entsprechender Vorsatz vorliegt.[131]
43
Dennoch müssen umgekehrt auch nicht immer alle objektiven und subjektiven Komponenten gleich und in jeweils vollem Ausmaß und Umfang ausgeprägt sein. Insbesondere ist nicht selbstverständlich, dass trotz der erhöhten subjektiven Komponente jeweils in völlig identischer Weise auch der objektive Handlungsunwert erfüllt sein müsste. Jenseits der Minimalgrenze der nicht vollständigen Ersetzbarkeit (vgl. o.) lassen sowohl die Vorstellung eines qualitativ gesamtbewertenden Urteils[132] als auch das Bild einer additiven Zusammenfügung von objektivem und subjektivem Handlungsunrecht zu, dass ein Plus des einen Elementes gewisse Defizite des anderen ausgleicht, insbesondere soweit diese funktionsäquivalent sind.[133]
44
Ganz konkret erscheint ein Verzicht auf solche objektiven Komponenten i.S. eines gewissen Grades an Sorgfaltspflichtverletzung und Vorhersehbarkeit möglich, wenn der Vorsatz des Täters zu bejahen ist. Denn diese Grenzen für eine Fahrlässigkeitshaftung bestehen ja gerade nur im Interesse des Nicht-Wissenden, um dessen Sorgfalts- und Nachprüfungspflichten nicht maßlos überzustrapazieren. Daneben legt eine solche Zusammenschau von objektiven und subjektiven Handlungsunrechtselementen durchaus nahe, dass bei verschiedenen objektiven Handlungsunwerten auch ein unterschiedlicher Grad an subjektivem Handlungsunwert erforderlich ist bzw. genügen kann.
6. Abschnitt: Die Straftat› § 29 Handlungs- und Erfolgsunrecht sowie Gesinnungsunwert der Tat› D. Erfolgs- und Handlungsunrecht in der Rechtsprechung
D. Erfolgs- und Handlungsunrecht in der Rechtsprechung
45
Wie bereits angedeutet, tauchen die Begriffe des Erfolgs- und Handlungsunrechts (bzw. „Unwerts“) in der Rechtsprechung – zumindest im Zusammenhang mit dogmatischen Streitfragen – kaum auf (was in Anbetracht dessen, dass die tatbestandsorientierte Jurisprudenz ohnehin nur in Ausnahmefällen auf abstrakte Begrifflichkeiten der allgemeinen Verbrechenslehre zurückgreift, auch nicht überrascht).[134] Indessen wird dieses Begriffspaar sehr häufig im Rahmen der Strafzumessung herangezogen, genauer: in Bezug auf die Strafzumessungsschuld: Das Begriffspaar hat im Rechtsprechungskontext insofern einen eigenständigen Gehalt (mithin nichts mehr mit dem „Unrechtsbegriff“ als solches zu tun). Es steht dort für das Beziehungsverhältnis von Tat („Erfolgsunwert“)[135] und Täter („Handlungsunwert“[136]). Art und Ausmaß des „Erfolgs“, die außertatbestandsmäßigen Folgen der Tat und eine etwaige Schadenswiedergutmachung können den Erfolgsunwert der Tat beeinflussen, während Beweggründe und Ziele des Täters, das Maß der Pflichtwidrigkeit sowie das Vor- und Nachtatverhalten bei der Bestimmung des Handlungsunwerts zu berücksichtigen sind. Da etwaige Schadensgrenzen oder Mindesthöhen (nicht geringe Menge Betäubungsmittel, Unfallschaden, konkrete Zahl an Gefährdeten) u.U. überhaupt die Anwendung des Tatbestands begründen (insb. bei Qualifikationsmerkmalen), ist darauf zu achten, dass der Erfolgsunwert bei der Strafzumessung nicht doppelt verwertet wird, § 46 Abs. 3 StGB.
46
Parallelen sind dennoch zu erkennen, wenn die Rechtsprechung diesbezüglich betont, dass die „(personale) Handlungskomponente und die (tatbezogene) Erfolgskomponente der Strafzumessungsschuld (…) nicht getrennt betrachtet werden“ können, sondern „einer Gesamtwürdigung zu unterziehen“ sind, in der ein Weniger an Erfolgsunwert (im konkreten Fall: Beutewert) durch ein Mehr an Handlungsunwert (in concreto: die beharrliche Nichtbeachtung diverser einschlägiger Strafen, Tatbegehung in laufender Bewährungszeit kurz nach letzter Verurteilung zu Freiheitsstrafe wegen gleichartiger Tat) kompensiert werden kann.[137]
6. Abschnitt: Die Straftat› § 29 Handlungs- und Erfolgsunrecht sowie Gesinnungsunwert der Tat› E. Zusammenfassung
47
Kehrt man auf dieser Grundlage einmal zu der eingangs aufgeworfenen Frage zurück, wie „ein bestimmtes Verhalten eigentlich zu einer Straftat“ wird bzw. was das Unrecht einer Straftat ausmacht, so lässt sich darauf folgende abgestufte Antwort geben:[138]
48
1.Wird durch eine Handlung ein Rechtsgut beeinträchtigt, so begründet dies das Erfolgsunrecht, wobei man die Eigenschaft des Erfolgsunrechts als „konstitutiv“ auch an der Frage messen muss, wie man den Begriff des Erfolgsunrechts versteht, insb. ob man ihn mit dem des Außenwelterfolgs gleichsetzt.
49
2.Ist diesbezüglich Vorsatz des Handelnden zu bejahen, dann spricht auf Grund der großen Bedeutung der subjektiven Handlungsunrechtskomponente ein erster „Hinweis“[139] für das Vorliegen auch des Handlungsunrechts.[140] Dies beruht darauf, dass einige typischerweise unrechts begründende objektive Handlungsunrechtselemente des Fahrlässigkeitsdelikts beim Vorsatzdelikt verzichtbar sind, und es bestätigt auch die unrechtsindizierende Wirkung der Verletzung von Rechtsgütern auf grundsätzlich strafrechtlich relevanten Angriffswegen.
50
3.Dieser vorläufige Hinweis kann aber durch bestimmte objektive Gesichtspunkte widerlegt werden, die auf Grund ihrer Existenz – unabhängig von der subjektiven Einstellung des Täters – einer Missbilligung des Verhaltens und damit dem Handlungsunrecht entgegenstehen. Diese Gesichtspunkte bilden die Fallgruppen der „objektiven Zurechnung“ bzw. des „nicht tatbestandsmäßigen Verhaltens“, soweit bei diesen (einhellig) die Kenntnisse des Täters für unbeachtlich gehalten werden.[141] Daneben gibt es aber auch Fälle, in denen das Handlungsunrecht ausgeschlossen ist, weil die objektiven und subjektiven Handlungsunwertkomponenten jeweils nur abgeschwächt vorliegen und daher entgegen dem ersten Hinweis zusammen nicht in der Lage sind, tatsächlich das Unrecht der Tat zu begründen.
51
4.Ohne dass damit zu weitgehende Übereinstimmung in den Details behauptet werden soll, findet sich der Gedanke des „Zusammenwirkens“ von objektiven und subjektiven (Handlungs-)Unrechtskomponenten in ganz ähnlicher Weise bereits vor vielen Jahren bei Roxin , wenn er (mit Blick auf die Möglichkeit eines unterschiedlichen objektiven Zurechnungsmaßstabes bei vorsätzlichem und fahrlässigem Verhalten) ausführt: „Das hat nichts Befremdliches, wenn [man] sich einmal klarmacht, daß die einzelnen ‚Elemente‘ des äußeren oder inneren Geschehens (. . .) nicht gleich Bausteinen unverrückbar an eine bestimmte Stelle des Systems ‚gehören‘, sondern daß die Frage nur dahin gestellt werden darf, ob und inwieweit ein subjektives oder objektives Merkmal unter dem Gesichtspunkt der Handlungs-, Unrechts- oder Schuldzurechnung relevant ist. Dabei kann es durchaus so sein, daß z.B. ein Element (…) für die Handlungszurechnung hier bedeutsam und dort unerheblich ist, (. . .) Eben darin liegt der prinzipielle Unterschied zwischen einem (. . .) die Straftat aus Geschehenspartikeln zusammensetzenden und einem an Zurechnungsmaßstäben orientierten teleologischen System. Bei der letztgenannten Systembildung liegt die Einheit nicht in der Identität des (. . .) Materials, sondern in der teleologischen Zusammengehörigkeit von Zurechnungsprinzipien (. . .)“.[142]
Читать дальше