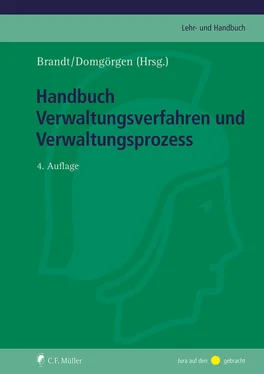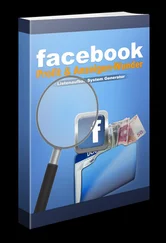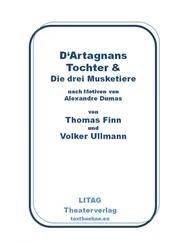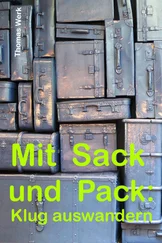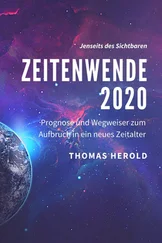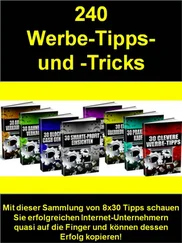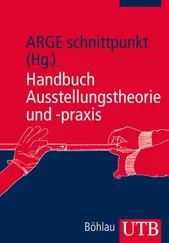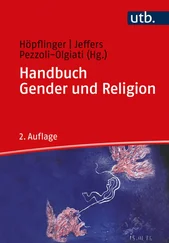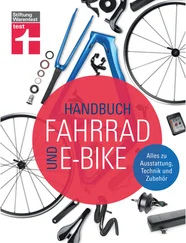E. Die Vollstreckung von Verwaltungsentscheidungen› II. Die Vollstreckung von Geldforderungen › 3. Vollstreckungsschuldner
3. Vollstreckungsschuldner
5
Als Vollstreckungsschuldner dürfen nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen in Anspruch genommen werden Selbst-, Haftungs- und Duldungsschuldner (§ 2 VwVG bzw. §§ 4 und 10 VwVG NRW).
6
Selbstschuldner ist, wer eine Leistung als persönliche Schuld erbringen muss.[10] Dies ist auch der Gesamtrechtsnachfolger, etwa im Fall der Erbfolge; die Nachlassverbindlichkeit stellt nach § 1967 BGB eine Verbindlichkeit des Erben selbst dar. Als Selbstschuldner kommen ferner Gesamtschuldner in Betracht, z.B. Miterben gemäß § 2058 BGB.[11]
7
Haftungsschuldner haben kraft Gesetzes für eine Leistung, die ein anderer schuldet, an seiner Stelle oder neben ihm mit ihrem Vermögen einzustehen.[12] Dies trifft insbesondere zu auf den Erwerber eines Handelsgeschäfts nach § 25 HGB, den persönlich haftenden Gesellschafter für die Schulden der OHG (§ 128 HGB) und den Komplementär für die Schulden der KG (§§ 161 Abs. 2, 128 HGB, ferner die Fälle der §§ 69 ff. AO). Hingegen ist der Bürge nicht als Haftungsschuldner anzusehen, weil seine Haftung nicht auf Gesetz, sondern auf vertraglicher Verpflichtung beruht.[13]
8
Der Duldungsschuldner muss nur die Vollstreckung in Vermögensgegenstände, die seiner Verwaltung unterliegen, dulden, haftet aber nicht mit seinem eigenen Vermögen.[14] Beispiele sind Testamentsvollstrecker (§ 2213 BGB), Nachlassverwalter (§ 1985 BGB) oder Nießbraucher (§ 1086 BGB), ferner, wer nach § 77 AO zur Duldung verpflichtet ist.
Eine Duldungspflicht begründen auch auf Grundbesitz ruhende öffentliche Lasten (§ 4 Abs. 3 VwVG NRW). Als solche werden in bundes- und landesrechtlichen Vorschriften nur solche Abgaben ausdrücklich bezeichnet, die in einem inneren Zusammenhang mit dem Grundstück stehen, insbesondere für Leistungen geschuldet werden, die der dauernden Werterhaltung oder -steigerung des Grundstücks dienen.[15] Zu nennen sind etwa Grundsteuern, Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge oder Kehr- und Überprüfungsgebühren des Schornsteinfegers. In diesen Fällen muss der Eigentümer auch wegen solcher Rückstände, die nicht von ihm selbst herrühren, die Vollstreckung in den eigenen belasteten Grundbesitz dulden oder die Vollstreckung durch Leistung aus eigenen Mitteln abwenden.
9
Reihenfolge der Inanspruchnahme.Eine Rangfolge der Haftung zwischen Selbst- und Haftungsschuldner ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Die Vollstreckungsbehörde hat insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, auf welchen Schuldner sie zugreift. Grundsätzlich wird sie zuerst den Selbstschuldner in Anspruch nehmen müssen; ein Zugriff auf den Haftungsschuldner ist nur unter besonderen Umständen zulässig – etwa weil eine Inanspruchnahme des Selbstschuldners keinen Erfolg verspricht – und bedarf einer entsprechenden Begründung.[16]
E. Die Vollstreckung von Verwaltungsentscheidungen› II. Die Vollstreckung von Geldforderungen › 4. Vollstreckungsvoraussetzungen
4. Vollstreckungsvoraussetzungen
10
Allgemeines.Die Einleitung der Vollstreckung setzt zunächst die Existenz eines wirksamen Leistungsbescheides voraus, mit dem der Schuldner zur Zahlung aufgefordert worden ist (§ 3 Abs. 2a VwVG, § 6 Abs. 1 Nr. 1 VwVG NRW). Als belastender Verwaltungsakt ist der Leistungsbescheid mit den normalen Rechtsbehelfen (Widerspruch gemäß § 68 Abs. 1 VwGO und Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 VwGO) angreifbar. Das materielle Verwaltungsrecht und nicht das Vollstreckungsrecht entscheidet darüber, ob eine Forderung durch Leistungsbescheid geltend gemacht werden darf.
11
Bestimmtheit.Der Leistungsbescheid ist mehr als eine bloße Zahlungsaufforderung. Nach § 37 Abs. 1 VwVfG muss er eindeutig als Verwaltungsakt bezeichnet und im Hinblick auf den Adressaten und den Regelungsgehalt hinreichend bestimmt sein. Der Bescheid muss insbesondere eine verbindliche Zahlungsregelung enthalten; der – exakt bezeichnete – Schuldner muss ausdrücklich und unmissverständlich aufgefordert werden, die geschuldete, der Höhe und dem Grunde nach genau festgelegte Leistung bei einer bestimmten Zahlstelle zu bewirken. Insgesamt muss nach dem objektiven Erklärungsinhalt des Bescheides ohne Weiteres erkennbar sein, dass ab Eintritt der Unanfechtbarkeit die Leistungspflicht grundsätzlich nicht mehr in Frage gestellt werden kann.[17]
Gegenüber dem Duldungsschuldner muss der Bescheid das eindeutige Gebot enthalten, zur Vermeidung der Vollstreckung in eine näher bezeichnete Vermögensmasse die Begleichung der Schuld zu veranlassen.
12
Bekanntgabe.Der Leistungsbescheid muss ferner, um Wirksamkeit zu erlangen, ordnungsgemäß bekannt gegeben werden (§§ 43 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 1 VwVfG).[18] Ist er für mehrere Personen bestimmt, muss er, wenn kein Fall der Bevollmächtigung gegeben ist, jedem der Beteiligten gegenüber bekannt gegeben werden. Im Fall von Eheleuten bedeutet dies, dass jeder Ehepartner eine eigene Ausfertigung des Leistungsbescheides erhalten muss.[19]
13
Vollziehbarkeit.§ 3 Abs. 2 lit. a VwVG bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 VwVG NRW setzen nicht die Unanfechtbarkeit des Leistungsbescheides voraus.[20] Gleichwohl macht die Einleitung der Vollstreckung vor Eintritt der Bestandskraft, soweit mit dem Leistungsbescheid keine öffentlichen Abgaben oder Kosten geltend gemacht werden, keinen Sinn, weil der Schuldner Widerspruch einlegen bzw. Klage erheben und damit die weitere Vollziehung hemmen könnte (§ 80 Abs. 1 VwGO). Meint die Behörde, den Eintritt der Unanfechtbarkeit des Leistungsbescheides nicht abwarten zu können, bleibt ihr nur die Möglichkeit, dessen sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO anzuordnen. Dies setzt allerdings voraus, dass ein besonderes öffentliches Vollziehungsinteresse besteht, welches schriftlich begründet werden muss (§ 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO). Eine andere Ausgangsposition ist für die Behörde bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten gegeben, weil hier Widerspruch und Klage des Betroffenen kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung haben (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO).[21] Dieser hat allerdings die Möglichkeit, einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung bei der Behörde (§ 80 Abs. 4 VwGO) bzw. beim zuständigen Verwaltungsgericht (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO) zu stellen; gleiches gilt im Fall einer behördlichen Vollziehungsanordnung.
14
Gleichgestellt sind dem Leistungsbescheid nach § 6 Abs. 2 VwVG NRW die Selbstberechnungserklärung des Schuldners bei Abgaben, die er der Höhe nach selbst einzuschätzen hat, und die Beitragsnachweisung, die der Arbeitgeber nach der Satzung eines gesetzlichen Krankenversicherungsträgers gegenüber der Krankenkasse hinsichtlich der Beiträge zur Sozial- und zur Arbeitslosenversicherung abgeben muss.
b) Fälligkeit der Leistung
15
Die Vollstreckung setzt weiterhin voraus, dass die Leistung des Schuldners fällig ist (§ 3 Abs. 2 lit. b VwVG, § 6 Abs. 1 Nr. 2 VwVG NRW), der Gläubiger sie also verlangen kann. Die Fälligkeit von Geldforderungen richtet sich nach materiellem Recht, sie wird hinausgeschoben, wenn die Behörde (etwa nach § 12 Abs. 1 Nr. 5a KAG NRW i.V.m. § 222 AO analog) Stundung gewährt.
16
Dem Schuldner wird vor Einleitung der Vollstreckung eine einwöchige Schonfrist eingeräumt (§ 3 Abs. 2 lit. c VwVG, § 6 Abs. 1 Nr. 3 VwVG NRW). Damit wird nicht der Fälligkeitstermin hinausgeschoben, dem Schuldner wird nur die Gelegenheit gegeben, die Leistung freiwillig zu erbringen, um so die Vollstreckung abzuwenden. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Leistungsbescheides bzw., wenn dieser vor Fälligkeit der Leistung bekannt gegeben worden ist, mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung. Eine Schonfrist muss nicht eingehalten werden in den Fällen des § 6 Abs. 4 VwVG NRW. Wartet die Behörde die Wochenfrist nicht ab, begeht sie zwar einen Verfahrensfehler. Dieser wird jedoch durch den nachträglichen Ablauf der Frist geheilt.[22]
Читать дальше