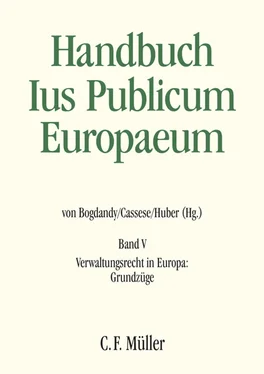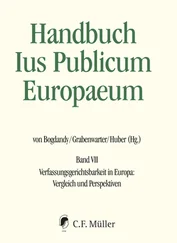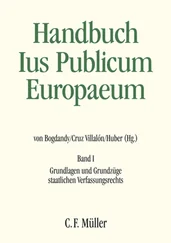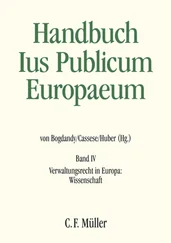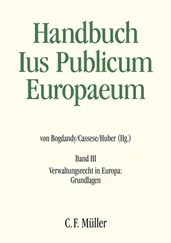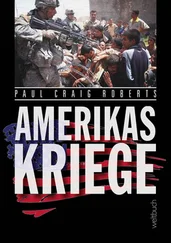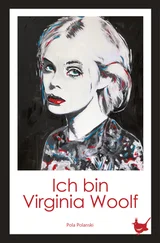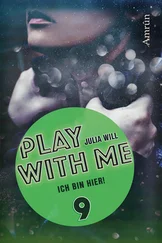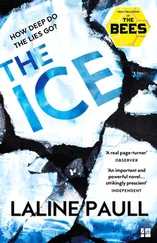c) Europäisierung und Internationalisierung
25
Europäisierung und Internationalisierung haben dazu beigetragen, die zentrale Rolle des Staates für die öffentliche Verwaltung zu relativieren und ein Verwaltungsrecht jenseits des Staates hervorgebracht,[40] das die Teilnehmer am Rechtsverkehr naturgemäß unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Verwaltungsrechtsordnung trifft.
26
Die Europäisierung[41] hat vor allem seit Ende der 1980er-Jahre teilweise erhebliche Überformungen, Modifikationen und Verdrängungen des nationalen Verwaltungsrechts mit sich gebracht. Da das Gemeinschafts- bzw. Unionsrecht eine Querschnittsmaterie ist, ist die Europäisierung des Verwaltungsrechts – dem Prozess der Konstitutionalisierung nicht unähnlich – mit einer so großen „Tiefenwirkung“ verbunden, dass man in Deutschland von einer „zweiten Phase des Öffentlichen Rechts unter dem Grundgesetz“ spricht.[42]
27
Technisch erfolgt die Europäisierung durch die Rechtsetzung der Europäischen Union und ihre Implementation in die Verwaltungsrechtsordnungen der Mitgliedstaaten, die auf den Vorrang des Unionsrechts und seine einheitliche Geltung fixierte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ferner durch spill-over- Effekte, d.h. die faktische Präjudizierung des nationalen Gesetzgebers und die Prägung von Verwaltungsbeamten und Richtern, die mit der Anwendung des Unionsrechts gesammelte Erfahrungen unwillkürlich auch auf die Auslegung und Anwendung des nationalen Rechts übertragen.[43] Kollisionen zwischen Unionsrecht und nationalem Recht gehen daher praktisch immer zugunsten des Unionsrechts aus.[44] In Italien, Kroatien oder Österreich trägt die verfassungsrechtliche „Veredelung“ von Unionsrecht und EMRK zu einer noch weiter gehenden Durchdringung des nationalen Rechts durch europäische Vorgaben bei.
28
Von der (Neu-)Austarierung von Legalitätsprinzip und Vertrauensschutz bei der Rücknahme von Verwaltungsakten über die Entmaterialisierung und Prozeduralisierung des Verwaltungsrechts, die Rekonstruktion der Daseinsvorsorge ( service public ) und des Staatshaftungsrechts bis zu teilweise erheblichen Modifikationen der nationalen Verwaltungsorganisation und des Verwaltungsprozessrechts – die Europäisierung hat substantiell zu einer Homogenisierung der Verwaltungsrechtsordnungen in Europa beigetragen. Diese Entwicklung dauert an.
29
Obwohl die Europäisierung das nationale Verwaltungsrecht zu Anpassungen und Veränderungen zwingt und deshalb zunächst meist Abwehrreflexe in den betroffenen Verwaltungsrechtsordnungen auslöst, wird ihr Innovationspotential mit einem gewissen Abstand doch überwiegend anerkannt.[45] Ein wenig überraschend wirkt dabei, dass die der Europäisierung geschuldeten Anpassungen und Veränderungen kaum als grundlegende Systemverschiebung empfunden, sondern Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Rezeptionsoffenheit des eigenen Verwaltungsrechts betont werden.[46]
bb) Internationalisierung
30
Die Internationalisierung und die mit ihr verbundenen Trends der Ökonomisierung und Privatisierung verstärken angesichts der fortgeschrittenen Liberalisierung des Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs den Wettbewerb der (Verwaltungs-)Rechtsordnungen; sie erfordern eine intensivierte globale Kommunikation und zwingen die einzelnen Verwaltungsrechtsordnungen über die Idee der „ best practice “ jedenfalls faktisch zu Anpassungen. Pars pro toto sei insoweit das im Gefolge der Privatisierungen nach 1989/1990 entstandene Regulierungsverwaltungsrecht genannt, das typischerweise durch mehr oder weniger unabhängige Agenturen vollzogen wird, die (vorübergehende) Konjunktur Öffentlich Privater Partnerschaften u.a.m.
4. Ein gemeineuropäisches Verwaltungsrecht im Werden
31
Internationalisierung, Ökonomisierung und Privatisierung sowie vor allem die europäische Integration haben so vor allem seit der Zeitenwende der Jahre 1989/1990 zu unübersehbaren Konvergenzen in den Verwaltungsrechtsordnungen des europäischen Rechtsraums geführt. Diese rechtfertigen es, bei allen verbleibenden und teilweise neu akzentuierten Differenzen, von der Existenz eines gemeineuropäischen Verwaltungsrechts zu sprechen, das sich insbesondere drei Herausforderungen gegenüber sieht: der Notwendigkeit, eine möglichst gute Erfüllung der Verwaltungsaufgaben sicherzustellen, der Gewährleistung einer hinreichenden Rückbindung der Verwaltungstätigkeit an den Willen des Wählers, d.h. der politischen Mehrheit, sowie der Sicherung eines wirkungsvollen Schutzes des Bürgers gegenüber dem Verwaltungshandeln.
32
Dieses gemeineuropäische Verwaltungsrecht kann als ein allen Staaten des europäischen Rechtsraums gemeinsamer Bestand an Prinzipien verstanden werden (dazu unter III.), der die Grundlagen der Verwaltung (dazu unter IV.) ebenso prägt wie ihre Instrumente und Verfahren (dazu unter V.) und der seine maßgeblichen Bezugspunkte in der demokratischen Legitimation und Kontrolle des Verwaltungshandelns (dazu unter VI.) sowie in der rechtsstaatlich geforderten Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes gegen Maßnahmen der Verwaltung (dazu unter VII.) findet. Dies sind zugleich die Orientierungspunkte für eine an den Belangen der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtete „gute Verwaltung“ (dazu unter VIII.).
Einführung› § 73 Grundzüge des Verwaltungsrechts in Europa – Problemaufriss und Synthese› III. Prinzipien des Verwaltungsrechts im europäischen Rechtsraum
III. Prinzipien des Verwaltungsrechts im europäischen Rechtsraum
33
Betrachtet man die Prinzipien und Grundsätze, die die europäischen Verwaltungsrechtsordnungen prägen, so variiert ihre Konkretisierung im Detail zwar durchaus. Umfang und Bestand dieser Prinzipien weisen – nach über 60 Jahren europäischer Integration und einer umfangreichen Spruchtätigkeit von Europäischem Gerichtshof und Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte nicht ganz überraschend – jedoch ein hohes Maß an Homogenität auf. Insofern lassen sich die nationalen Prinzipien des Verwaltungsrechts weitgehend bruchlos mit den Vorgaben aus Art. 4 und 6 EUV sowie Art. 6 und 13 EMRK vereinbaren.
34
In einem konkreteren Sinne sind es vor allem das Legalitätsprinzip (dazu unter 1.), die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (dazu unter 2.), der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (dazu unter 3.) und der Gleichheitssatz (dazu unter 4.), die als allgemein anerkannt gelten können. Alle nationalen Verwaltungsrechtsordnungen sichern die Kontrolle der Verwaltung darüber hinaus nicht nur, aber vor allem durch die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes (dazu unter 5.).[47] Weiter gehende Prinzipien und Grundsätze haben sich bislang jedenfalls nicht europaweit etablieren können (dazu unter 6.).
1. Legalitätsprinzip
35
Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, insbesondere ihre Ausprägung im Vorrang des Gesetzes ,[48] dem Legalitätsprinzip ( principe de légalité ou juridicité ), ist der überragende Grundsatz des Verwaltungsrechts in allen europäischen Verwaltungsrechtsordnungen. Sie ist – je nach Akzent – eine Konkretisierung des Rechtsstaats- wie des Demokratieprinzips, die den Primat des Parlaments gegenüber der Verwaltung absichert, oder die Kompensation für die besonderen Befugnisse und Vorrechte der Verwaltung.[49]
36
Weil die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nicht nur die demokratische Mehrheitsherrschaft absichert, sondern auch die Gleichheit aller vor dem Gesetz garantiert, ist es problematisch, der Verwaltung eine Disposition über das Legalitätsprinzip zu gestatten. Das schließt Kollisionen des Legalitätsprinzips mit anderen Prinzipien vergleichbaren Ranges nicht aus. Alle Verwaltungsrechtsordnungen – die unionale eingeschlossen – gestatten etwa im Interesse des Vertrauensschutzes eine begrenzte Relativierung des Legalitätsprinzips. Eine Regelung wie der deutsche § 48 Abs. 1 VwVfG, die es der Verwaltung ermöglicht, Verstöße gegen das Legali- tätsprinzip auch aus bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen aufrecht zu erhalten, ist im europäischen Vergleich hingegen ein problematischer Sonderfall.
Читать дальше