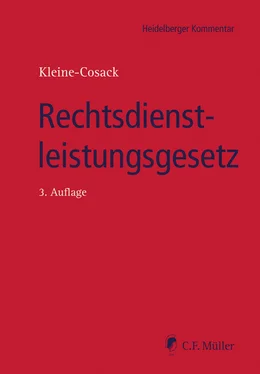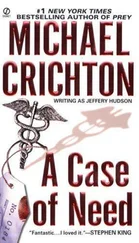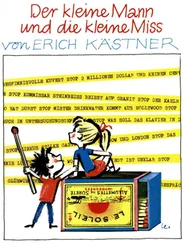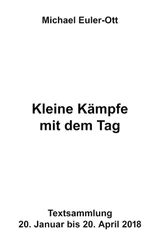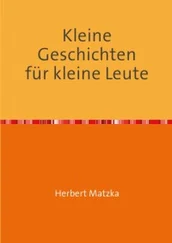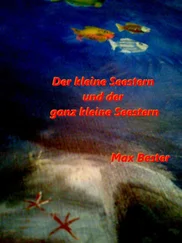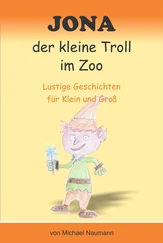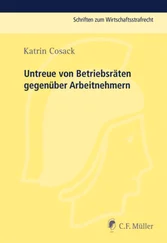V. Veränderte politische Bedingungen
20
Die mit dem RDG verbundene Liberalisierung des Rechtsdienstsrechts muss vor dem Hintergrund des allgemeinen Abbaus freiberuflicher Monopole sowie der massiven Veränderungen in der Berufswelt gesehen werden.
1. Deregulierung der freien Berufe
21
Die freien Berufe geraten seit einigen Jahren verstärkt unter politischen und rechtlichen Druck. Ihre Sonderstellung, welche sie seit der Antike als artes liberales für sich reklamieren, wird zwischenzeitlich in Frage gestellt.[37] Maßgeblich für diese Entwicklung ist vor allem die Öffnung der bisher abgeschotteten Volkswirtschaften. Innerhalb der EU wie auch international bilden sich einheitliche Märkte, welche auch den Dienstleistungssektor erfassen. Die damit verbundenen politischen Bestrebungen zur Herstellung einheitlicher Binnenmärkte sowie von (Wettbewerbs-) Freiheit machen auch vor den freien Berufen nicht halt. Die EU hat sich die Deregulierung des Dienstleistungsmarktes seit den Lissabonner Beschlüssen auf ihre Fahnen geschrieben. Die freien Berufe können sich von dieser Entwicklung nicht abkoppeln, zumal sie sich massiv anderen gewerblichen Berufen angenähert haben.[38]
22
Auch das Berufsrecht der rechts- und steuerberatenden Berufe bedarf der Überprüfung, da es vielfach weniger am Gemeinwohl als an zunftorientierten Traditionen und Konkurrenzschutz orientiert ist. Es war daher nur eine Frage der Zeit, wann auch die in Deutschland seit 1935 bestehenden Beschränkungen auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt abgebaut werden, wie dies durch die Rechtsprechung seit 1998 und 2007 mit dem RDG geschehen ist mit der Folge des Endes des Rechtsberatungsmonopols der Anwaltschaft und eines weitgehend liberalisierten Rechtsdienstleistungsmarkts mit offenem Wettbewerb der Anbieter von Rechtsdienstleistungen, in denen – trotz unvermeidlicher Informationsasymmetrie – der mündige Verbraucher verstärkt über die Rechtsberaterwahl entscheiden kann.
2. Wandel auf dem Rechtsberatungsmarkt
23
Der skizzierte Kurswechsel war nicht nur verfassungs- und europarechtlich sondern auch angesichts des tiefgreifenden Wandels überfällig, den der Rechtsberatungsmarkt seit den 90er Jahren durchläuft und der es verbietet, bei jeder Rechtsberatung nichtanwaltliche Berater und Verbraucher zu zwingen, einen Rechtsanwalt einzuschalten.
a) Gesellschaftliche Entwicklungen
24
In der Begründung des Gesetzentwurfs[39] wird darauf hingewiesen, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre, die den Ruf nach einer grundlegenden Reform des Rechtsberatungsgesetzes haben laut werden lassen, zutreffend mit dem Stichwort der „Verrechtlichung“ im Sinn einer rechtlichen Durchdringung nahezu aller Lebensbereiche beschrieben worden sind. Diese Verrechtlichung betrifft vor allem wirtschaftliche, aber auch medizinische, psychologische oder technische Tätigkeiten mit der Folge, dass kaum eine berufliche Betätigung ohne rechtliches Handeln und entsprechende Rechtskenntnisse möglich ist oder ohne rechtliche Wirkung bleibt. Bemühungen um eine „Entrechtlichung“, wie sie etwa in der Entstehung neuer Streitschlichtungsformen wie der Mediation sichtbar werden, stellen sich letztlich gleichfalls als Reaktion auf diese zunehmende rechtliche Durchdringung aller Lebensbereiche dar.
b) Neue Dienstleistungsberufe
25
Als Folge hieraus haben sich, angefangen von Patentüberwachungsunternehmen über Erbenermittler bis hin zu Energieberatern, Fördermittelberatern, Baubetreuern oder nichtanwaltlichen Mediatoren, neue Berufe herausgebildet, zu deren Wahrnehmung im Annex auch eine Rechtsberatung unverzichtbar ist. Die Entwicklung in diesem Bereich ist fließend; sie geht einher mit Veränderungen im Bereich älterer, klassischer Berufsbilder, deren Bedeutung teilweise abnimmt.[40]
26
Auch im Bereich der Hochschulausbildung wird der zunehmenden Verrechtlichung des Wirtschaftslebens durch neue Studiengänge Rechnung getragen:[41] Universitäts- und Fachhochschulstudiengänge verbinden wirtschafts- oder sozialwissenschaftliche Ausbildungsinhalte mit einem juristischen Studienschwerpunkt. Mittlerweile wird der ursprünglich auf die Qualifikation der Studierenden für eine Tätigkeit in einem Wirtschaftsunternehmen ausgerichtete Studiengang Wirtschaftsrecht an über zwanzig Fachhochschulen und an mehreren Universitäten angeboten. Bei den Studieninhalten entfallen mindestens 50 % auf das Wirtschaftsrecht und 25 % auf Betriebs- und Volkswirtschaftslehre; zusätzlich werden Schlüsselqualifikationen (z. B. Sprachen, Informatik, Rhetorik, soziale Kompetenz) angeboten. Nach einer regelmäßig achtsemestrigen Studiendauer erlangen derzeit jährlich etwa 800 Absolventen den Abschluss Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) bzw. Bachelor of Laws – LLB als berufsqualifizierenden Abschluss. Angesichts dieser Entwicklung verleihen mittlerweile auch zahlreiche Universitäten den Studierenden mit dem erfolgreichen Abschluss der Ersten Staatsprüfung ein universitäres Abschlussdiplom.
27
Diesen Absolventen muss das Recht auf selbstständige juristische Betätigungen zugestanden werden. Es wird ihnen bisher noch verfassungs- und europarechtswidrig verweigert, wie das Scheitern einer gerichtlichen Erzwingung des Rechts zu selbstständiger rechtsberatender Tätigkeit gezeigt hat.[42]
28
Der Gesetzgeber des RDG hat in nicht haltbarer Weise argumentiert, dass Belange des Verbraucherschutzes – so die ABG[43] – der Einführung eines Rechtsdienstleistungsberufs unterhalb der Rechtsanwaltschaft entgegen stehen würden.
29
„Als Folge der aufgezeigten Entwicklung im Bereich der juristischen Fachhochschulstudiengänge haben insbesondere die Diplom-Wirtschaftsjuristen für sich und für Absolventen vergleichbarer juristischer Hochschul- oder Fachhochschulstudiengänge (z. B. Diplom-Sozialjuristen, Diplom-Informationsjuristen) die Befugnis zur selbstständigen außergerichtlichen Rechtsberatung gefordert. Der im Schwerpunkt juristische Fachhochschulstudiengang ende mit einem berufsqualifizierenden Abschluss, der nicht nur zur abhängigen Beschäftigung in einem Unternehmen, sondern auch zur selbstständigen Berufsausübung berechtigen müsse. Dieser Forderung hat sich zuletzt auch die Monopolkommission angeschlossen, (Sechzehntes Hauptgutachten „Mehr Wettbewerb auch im Dienstleistungssektor!“ vom 5. Juli 2006, http://www.monopolkommission.de/haupt. html). Sie hält darüber hinaus die Einführung einer Rechtsdienstleistungsbefugnis für alle Absolventen eines juristischen Studiengangs für geboten.
In der Tat könnte die Frage, ob Absolventen eines juristischen Studiengangs eine eigenständige, umfassende Befugnis zur außergerichtlichen Rechtsberatung erhalten sollen nicht auf einen einzelnen Fachstudiengang beschränkt werden. Dies belegen die bereits heute vorhandenen zahlreichen interdisziplinären Universitäts- und Fachhochschulstudiengänge mit juristischem Ausbildungsschwerpunkt. Vielmehr könnte eine solche Befugnis allein an objektive Ausbildungskriterien, insbesondere an die Dauer des Studiums und den Anteil spezifisch juristischer Studieninhalte geknüpft werden. Insbesondere die Absolventen des „klassischen“ rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums dürften daher angesichts von Studiendauer und -inhalten des Jurastudiums nicht schlechter behandelt werden als Absolventen von Fachhochschulen; dies gilt unabhängig davon, ob sie das Studium mit der Ersten Staatsprüfung nach altem Recht oder nach neuem Recht abschließen und ob ihnen zusätzlich zu der staatlichen Prüfung ein Diplomgrad verliehen wird.
Die Zulassung all dieser Hochschulabsolventen zur selbstständigen Rechtsberatung würde indes dazu führen, dass jedenfalls im Bereich der außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen zwei Berufe – der des Rechtsanwalts und der des nichtanwaltlichen Rechtsberaters – nebeneinander bestehen, die bei völlig unterschiedlichen Ausbildungsstandards gleichartige Tätigkeiten anbieten.
Читать дальше