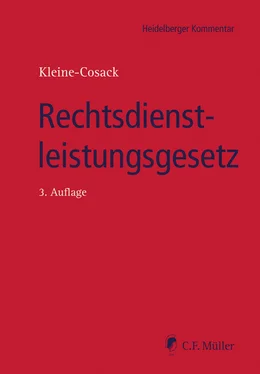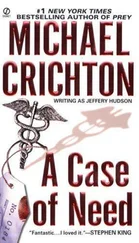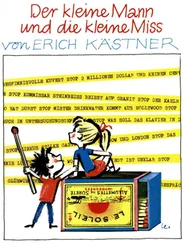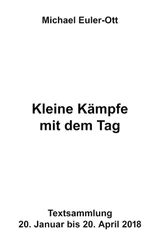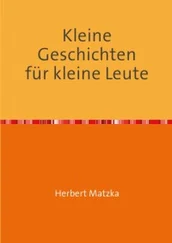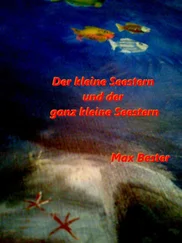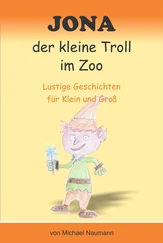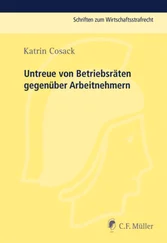42
Schon nach der Rechtsprechung des BVerfG zum RBerG kam diesem Aspekt allenfalls eine sehr beschränkte gemeinwohlrelevante Bedeutung zu.[41] Zu den Gemeinwohlbelangen im Zusammenhang mit einer ordnungsgemäßen Rechtspflege zähle bei der Abgrenzung spezialisierter Berufe und der ihnen vorbehaltenen Aufgaben zwar auch der Erhalt einer leistungsfähigen Berufsgruppe wie einer leistungsfähigen Anwaltschaft. Dieser Belang sei allerdings insofern nur von Bedeutung, als er dem unmittelbaren Gesetzeszweck diene. Schutz vor Wettbewerb könne allenfalls dann geboten sein, wenn sonstige Gemeinwohlbelange gefährdet würden, denen die Zugangsschranken oder Berufsausübungsregelungen eines Berufs gerade zu dienen bestimmt seien. Soweit eine fühlbare Beeinträchtigung der für eine ordnungsgemäße Rechtspflege benötigten Anwaltschaft nicht zu besorgen sei, könnten rechtliche Bestimmungen nicht zum Schutz vor oder gegen Konkurrenz dienen.[42] In einem Beschluss aus dem Jahre 2002 hat das BVerfG[43] den Konkurrenzschutz der Rechtsanwaltschaft als Gesetzeszweck überhaupt nicht mehr erwähnt.
b) Kein Schutz anwaltlicher Berufspflichten
43
Ebenso wenig dient das RDG – wie zum RBerG z. T. behauptet[44] – der Einhaltung anwaltlicher Berufspflichten. Würde man das RBerG aufheben und jedermann zur Rechtsberatung zulassen, würden die dabei für Anwälte bestehenden besonderen Rechte und Pflichten nicht gelten. Neben der Verschwiegenheit sei gerade das Verbot der Wahrnehmung widerstreitender Interessen eine wichtige Verbraucherschutzregelung zugunsten der rechtsuchenden Bürger.[45]
44
Diese Argumentation war bereits am Maßstab des RBerG und ist erst recht des RDG nicht haltbar. Auch die Rechtsprechung zum RBerG hatte – soweit ersichtlich – in keiner Entscheidung den Anwendungsbereich des RBerG durch Einbeziehung der Berufspflichten erweitert. Das BVerfG stellte im Masterpatbeschluss[46] nur darauf ab, ob durch die Tätigkeit Dritter „die Qualität der Dienstleistung oder die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und die zu ihrer Aufrechterhaltung benötigten Rechtsberater beeinträchtigt werden.“ Nichts anderes gilt für den BGH.[47] Er hat dies z. B. in den Medienrechtsentscheidungen[48] klargestellt mit der Verneinung eines Schutzes via RBerG gegen mediale Erpressung. Das BVerfG[49] hat zudem im Erbenermittlerfall keine Bedenken gegen die Vereinbarung eines – damals für Rechtsanwälte verbotenen – Erfolgshonorars geäußert. Es hat weiter in seiner Inkassoentscheidung[50] klargestellt, dass das RBerG den Schutz der Ratsuchenden, aber nicht den der Schuldner bezwecke. Auch in der eigenen Medienrechtsentscheidung hat das BVerfG dezidiert einer Erweiterung der Schutzzwecke eine Absage erteilt.[51]
45
„Das Rechtsberatungsgesetz verfolgt nicht den Zweck des Persönlichkeitsschutzes oder des Schutzes wirtschaftlicher Interessen der von einer Berichterstattung Betroffenen. Die anprangernde Wirkung, die von Rundfunksendungen des hier betroffenen Typs ausgehen kann, reicht daher als Ansatzpunkt nicht, um die Äußerung dem Rechtsberatungsgesetz zu unterwerfen (vgl. BGH, NJW 2002, S. 2877 <2878>). Dies bedeutet nicht, dass die Rechtsordnung die öffentliche Anprangerung stets hinnimmt (vgl. allgemein Edenfeld, JZ 1998, S. 645 ff.). Vielmehr gewährt sie Schutz vor der Verletzung von Persönlichkeitsrechten (etwa gemäß §§ 138, 823, 826, 1004 BGB), der auch gegenüber anprangernden Fernsehsendungen beansprucht werden kann. Insofern müssen die Betroffenen sich selbst vor einer möglichen Bloßstellung mit rechtlichen Mitteln schützen (vgl. BGH, NJW 2002, S. 2877 <2878>). Vor dem Einsatz unlauterer Mittel in Rundfunksendungen schützen auch die Regelungen des Rundfunkrechts. Dieses überträgt den Landesmedienanstalten Aufgaben zur Überwachung der Rundfunkprogramme unter anderem mit dem Ziel, die Einhaltung des Schutzes der Menschenwürde zu sichern (vgl. etwa § 31 Abs. 3, § 88 Landesmediengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Sollten die vorhandenen Rechtsnormen nicht ausreichen, um vor der öffentlichen Anprangerung hinreichend zu schützen, ist über eine gesetzliche Ausweitung des Schutzes zu entscheiden. Das Rechtsberatungsgesetz ist nach seiner gegenwärtigen Konzeption jedoch nicht zur Verwirklichung dieses Schutzzwecks bestimmt.“
46
Die besonderen Berufspflichten der Anwälte sind zudem allein die Folge ihrer Einschaltung und damit der Geltung des im RDG statuierten Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Sie sind ein „Markenzeichen“ anwaltlicher Tätigkeit, das Rechtsuchende veranlassen sollte, Rechtsanwälte auch einzuschalten, weil sie bei der Beratung durch nichtanwaltliche Dritten Gefahr laufen, (durch die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht) „verraten“ und „verkauft“ (durch Parteiverrat bzw. interessengegensätzliches Handeln) zu werden. Darüber hinaus haben zahlreiche Berufspflichten mit der Qualität der anwaltlichen Dienstleistung nichts oder nur wenig zu tun haben. Dies trifft z. B. für die Verschwiegenheitspflicht des § 43a II BRAO, strafrechtlich abgesichert durch § 203 StGB, zu.
47
Vor allem aber würde der Rekurs auf die Berufspflichten zu einer uferlosen Ausdehnung des Anwendungsbereichs des RBerG führen. Unstreitig erlaubnisfreie Tatbestände wären wie in der Vergangenheit zu Zeiten exzessiver Auslegung des Art. 1 § 1 Satz 1 RBerG erlaubnispflichtig. Das Abstellen auf die Berufspflichten führte zwangsläufig zu einem indiskutablen Totalvorbehalt, wie man ihn beim Erlass der Vorgängernorm des RBerG im Dritten Reich kannte, so dass sich schon deshalb weitere Erörterungen in diese Richtung verbieten.
48
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass mit § 1 I 2 RDGklargestellt ist, dass der Erlaubnisvorbehalt des RDG allein den dort genannten Zwecken und damit vor allem dem Schutz des Rechtsuchenden vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen dient.
IV. Spezialgesetz, Abs. 2
49
Das RDG regelt die Befugnis zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen nicht mehr abschließend.[52] Befugnisse zur Rechtsberatung oder Rechtsbesorgung können sich auch aus anderen Gesetzen ergeben. § 1 II RDGbestimmt: „Regelungen in anderen Gesetzen über die Befugnis, Rechtsdienstleistungen zu erbringen, bleiben unberührt.“ Rechtsdienstleistungsbefugnisse können sich daher auch aus anderen gesetzlichen Vorschriften ergeben. Damit ist die Geltung des eigentlich auch unter dem RBerG maßgeblichen,[53] jedoch von der h.A. verkannten bzw. abgelehnten Grundsatzes des „Lex specialis derogat legi generali“ gesetzlich bestimmt. Die Reichweite und Bedeutung der Bestimmung ist jedoch fraglich.
50
Durch § 1 IIwird das RDG im Verhältnis zu anderen Gesetzen als lex generalis gekennzeichnet.[54] Dies bedeutet einerseits, dass Rechtsdienstleistungsbefugnisse, die anderweitig wie z. B. in der BRAO, der WPO oder dem StBerG geregelt sind, keiner Regelung im RDG bedürfen, da sich deren Inhalt und Umfang allein aus dem Spezialgesetz ergeben. Die Konsequenz dieser ausdrücklichen Fixierung des RDG als lex generalis ist, dass es nur noch eine Auffangregelung beinhaltet, deren Bedeutung durch Spezialgesetze erheblich reduziert wird und zukünftig erst recht werden kann.
2. Bedeutung der Spezialgesetze
51
Fraglich kann jedoch im Einzelfall sein, welche Bedeutung dem Vorbehalt zugunsten von Spezialgesetzen zukommt. Das Verhältnis Spezialgesetz/RDG ist komplizierter, als sich das der Gesetzgeber vermutlich vorgestellt hat. Unklar ist, ob das RDG vollständig oder nur partiell verdrängt wird bzw. ob und in welchen Fällen trotz Spezialregelung das RDG noch Anwendung findet.
Читать дальше