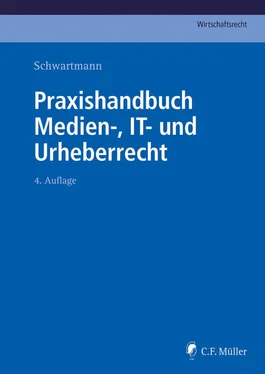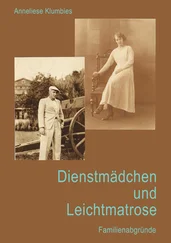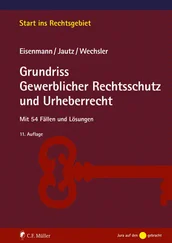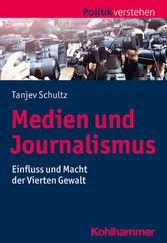3.1 Grundrechtliche Relevanz
3.2 Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern
II. Der Anwendungsbereich des TMG
1. Abgrenzung zum Rundfunk
1.1 Vorgaben der AVMD-Richtlinie
1.2 Linearität, Sendeplan und Allgemeinheit
1.3 Inhalteneutralität des einfachgesetzlichen Rundfunkbegriffs?
1.4 Ausnahmekatalog des § 2 Abs. 3 RStV
1.5 Einzelne Abgrenzungsfragen – Online-Auftritte mit audiovisuellen Elementen, „Rundfunk“ auf Videoplattformen und in Social Media, Business-TV
1.6 Rechtspolitische Bewertung und Ausblick
2. Unbedenklichkeitsbestätigung und Rückholklausel
3. Abgrenzung zu den Diensten des TKG
III. Regelungsregime der Telemediendienste
1. Begriffsbestimmungen
1.1 Diensteanbieter
1.2 Niedergelassener Diensteanbieter
2. Herkunftslandprinzip
2.1 Anwendungsbereich des Herkunftslandprinzips
2.2 Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip
2.2.1 Generelle Ausnahmen
2.2.2 Einzelfallausnahmen
3. Zulassungsfreiheit
4. Informationspflichten
4.1 Allgemeine Informationspflichten
4.2 Besondere Informationspflichten
4.3 Verbot von Spam
5. Haftungsprivilegierung
5.1 Das Prinzip der Haftungsprivilegierung
5.1.1 Anwendungsbereich der Verantwortlichkeitsregeln
5.1.2 Eigene und fremde Inhalte
5.1.3 Die Freistellung von der Verantwortlichkeit für fremde Inhalte
5.2 Die Haftung der Diensteanbieter im Einzelnen
5.2.1 Grundsätze des BGH zur Anbieterhaftung
5.2.2 Einzelfragen
6. Datenschutz
6.1Datenschutzvorschriften des TMG
6.1.1 Anwendungsbereich, § 11 TMG
6.1.2 Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
6.1.2.1 Gesetzliche Erlaubnis – Bestandsdaten und Nutzungsdaten, §§ 14, 15 TMG
6.1.2.2 Die Einwilligung des Nutzers
6.2 Auskunftsansprüche
6.3 Aktuelle Reformen im Datenschutzrecht
7. Weitere Anforderungen an journalistisch-redaktionell gestaltete und fernsehähnliche Telemedien
7.1 Telemedien ohne und mit journalistisch-redaktionell gestaltetem Inhalt
7.2 Journalistische Grundsätze
7.3 Weitergehende Informationspflichten
7.4 Gegendarstellung
7.5 Redaktionsdatenschutz
7.6 Werbung
IV. Öffentlich-rechtliche Telemedienangebote
V. Jugendschutz in den Neuen Medien
1. Angebotskategorien
1.1 Absolut unzulässige Angebote nach § 4 Abs. 1 JMStV
1.2 Relativ unzulässige Angebote nach § 4 Abs. 2 JMStV
1.3 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote, § 5 JMStV
1.3.1 Der Begriff der Entwicklungsbeeinträchtigung
1.3.2 Die Folgen einer Einstufung als entwicklungsbeeinträchtigend
2. Jugendschutzbeauftragter
2.1 Von der Verpflichtung erfasste Anbieter
2.1.1 Geschäftsmäßiges Anbieten von Telemedien
2.1.2 Allgemein zugängliches Telemedium
2.1.3 Enthalten von entwicklungsbeeinträchtigenden oder jugendgefährdenden Inhalten
2.1.4 Ausnahme für kleine Anbieter von Telemedien
2.2 Aufgaben des Jugendschutzbeauftragten
2.3 Anforderung an die Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten
VI. Aufsicht
Soziale Medien
11. Kapitel Rechtsfragen beim Einsatz sozialer Medien
I.Definition und Bedeutung
1. Begriff und Wesensmerkmale
2.Chancen der Nutzung von sozialen Medien
2.1 Unternehmen
2.2 Private
3.Risiken der Nutzung von sozialen Medien
3.1 Unternehmen
3.2 Private
4. Arten von sozialen Medien
4.1 Soziale Netzwerke
4.2 Instant Messaging-Dienste
4.3 Blogs
4.4 Microblogs
4.5 Wikis
4.6 Webforen
4.7 Bewertungsportale
4.8 Multimediaportale
II.Regelwerke der sozialen Medien
1. Anwendbares Recht
2. Leistungsumfang
3. Social Media-Vertrag
4. Wirksamkeit typischer Klauseln
5. Verstöße gegen Verhaltensregeln
6.Beendigung der Social Media-Nutzung
6.1 Kündigung
6.2 Tod des Accountinhabers
III. Betroffene Rechtsgebiete
1.Urheberrecht
1.1 Anwendbarkeit deutschen Urheberrechts
1.2 Eigene Inhalte
1.3 Fremde Inhalte
1.3.1 Hochladen fremder Werke
1.3.2 Verlinkung und Framing
2. Datenschutzrecht
2.1 Verfassungsrechtlicher Schutz personenbezogener Daten
2.2 Einfachgesetzlicher Schutz personenbezogener Daten
2.3Anwendbarkeit deutschen Datenschutzrechts
2.3.1 § 1 Abs. 5 BDSG als Kollisionsnorm
2.3.2 Verantwortliche Stelle innerhalb EU/EWR
2.3.3 Verantwortliche Stelle außerhalb EU/EWR
2.4 Personenbezogene Daten
2.5Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit
2.5.1 Social Media-Anbieter
2.5.2 Anbieter von Social Plug-Ins
2.5.3 Nutzer
2.6 Gesetzliche Grundlagen des Datenumgangs
2.7 Rechtsfragen transnationaler Datenübermittlung
3. Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht
3.1 Anwendbarkeit deutschen Rechts zum Schutze der Persönlichkeit
3.2 Meinungsfreiheit
3.3 Allgemeines Persönlichkeitsrecht
3.4Rechtsfolgen bei Persönlichkeitsverletzungen
3.4.1 Vorgehen gegen den Äußernden
3.4.2 Vorgehen gegen die Social Media-Anbieter
3.4.3 Maßnahmen der Social Media-Anbieter
3.5 Phänomen Fake News
4.Rundfunkrecht
4.1 Social Media als Rundfunk
4.2 Verfassungsrechtlicher Rundfunkbegriff
4.3 Einfachgesetzlicher Rundfunkbegriff
5. Telemedienrecht
5.1 Social Media als Telemedien
5.2 Anwendbarkeit deutschen Telemedienrechts
5.3Gesetzliche Vorgaben nach RStV
5.3.1 Anwendbarkeit rundfunkrechtlicher Vorschriften
5.3.2 Grundsatz der Zulassungsfreiheit
5.3.3 Inhaltliche Anforderungen an Telemedien
5.3.4 Impressumspflicht
5.3.5 Werberechtliche Grundsätze
5.3.6 Telemediale Aktivitäten öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten
5.4Gesetzliche Vorgaben nach TMG
5.4.1 Weitergehende Impressums- und Informationspflichten
5.4.2 Datenschutzrechtliche Vorgaben
6. Wettbewerbsrecht
6.1 Anwendbarkeit deutschen Wettbewerbsrechts
6.2 Schutzzweck des UWG
6.3 Die relevanten Tatbestände im Einzelnen
6.3.1 § 3 Abs. 1 UWG
6.3.2 § 3 Abs. 3 UWG
6.3.3 § 5a UWG
6.3.4 § 3a UWG
6.3.5 § 5 UWG
6.3.6 § 6 UWG
6.3.7 § 7 UWG
6.4Rechtsfolgen wettbewerbswidrigen Handelns
6.4.1 Unterlassungsanspruch
6.4.2 Abmahnung
6.4.3 Ersatz der Abmahnkosten
6.4.4 Schadensersatz und Gewinnabschöpfung
6.5 Vorgaben der Social Media-Anbieter
7.Jugendschutzrecht
7.1 Verhältnis von JuSchG und JMStV
7.2 Schutzrahmen des JMStV
7.3 Freiwillige Alterskennzeichnung für soziale Medien
8.Strafrecht
8.1 Soziale Medien als Ausgangspunkt strafbaren Verhaltens
8.2 Anwendbarkeit deutschen Strafrechts
8.3Materielle Straftatbestände
8.3.1 Mögliche Straftatbestände im Hinblick auf soziale Medien
8.3.2 Phänomen Sexting
8.3.3 Möglicher Reformbedarf
8.4 Prozessuale Eingriffsbefugnisse
9. Haftungsrecht
9.1Verantwortlichkeit der Nutzer
9.1.1 Haftung für eigene Inhalte
9.1.2 Haftung für fremde Inhalte
9.1.3 Minderjährige
9.2Verantwortlichkeit der Anbieter
9.2.1 Haftung für Datensicherheit
9.2.2 Haftung für eigene und fremde Anwendungen
9.2.3 Haftung für Inhalte der Nutzer
IV.Social Media im Unternehmen
1. Verpflichtung der Arbeitnehmer zur Nutzung von sozialen Medien
2.Private Nutzung sozialer Medien am Arbeitsplatz
2.1 Bedeutung
2.2 Erlaubnis privater Internetnutzung
2.3 Nachträgliches Verbot privater Internetnutzung
3. Festlegung des Nutzungsumfangs
4. Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats
5. Kontrolle durch den Arbeitgeber
5.1 Erlaubnis ausschließlich dienstlicher Internetnutzung
Читать дальше