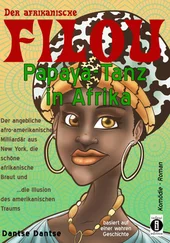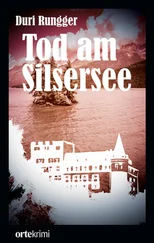Er lächelte bei der Erinnerung an den Tag, an dem er die Statue von einer Auktion in Paris heimgebracht und seiner Putzfrau, Frau Petrovic, gezeigt hatte. Mit Entsetzen hatte sie die Figur als «nackte Madonna» bezeichnet und sich vor Schreck über ihre Ketzerei dreimal bekreuzigt. Seither war diese Statue für ihn seine «Mater dolorosa», bei der er in stummem Zwiegespräch Zuflucht und Trost suchte, wenn er sich einsam und verzweifelt fühlte.
Heute brauchte er keinen Trost und riss sich rasch von ihrem Anblick los. Vor ein paar Tagen hatte er mit den Vorarbeiten für seine geplante Studie über die unterschiedliche Aussagekraft afrikanischer Skulpturen angefangen und brannte darauf, damit weiterzufahren. Er hatte bereits einige Skulpturen ein und desselben Stammes gefunden, die dieselbe rituelle Funktion hatten und dennoch eine sehr unterschiedliche künstlerische Qualität aufwiesen. Selbst in angesehenen Sammlungen und Museen fanden sich Skulpturen, die alt und ethnographisch wichtig und doch völlig ausdruckslos waren.
Das war nicht weiter erstaunlich. Nicht jeder Bauer hatte die Mittel, einem bekannten Schnitzer viel Geld für ein Kunstwerk für den Hausaltar in seiner bescheidenen Hütte oder eine Maske fürs Erntedankfest zu bezahlen – und vielleicht gab sich der Künstler entsprechend weniger Mühe. Bei manchen Stämmen zwangen Geister gewöhnliche Dorfbewohner, eine Statue herzustellen. Die «Berufenen» machten sich gezwungenermassen an die ihnen auferlegte Aufgabe, auch wenn sie unbegabt waren. Zudem mochte eine Figur den rituellen Ansprüchen genügen, ohne schön oder teuer zu sein. Die Anforderungen konnten sehr bescheiden sein. Beim Stamm der Lobi galt eine Statue bereits als gut, wenn sie auf dem Hausaltar nicht umfiel – und trotzdem fanden sich dort viele aussergewöhnlich ausdrucksstarke Skulpturen.
Gestern hatte er besonders schlagende Beispiele mit zwei Meisterwerken und entsprechenden, schwachen Gegenstücken gefunden, deren Abbildungen auf seinem Scanner kopiert und in seinem Computer gespeichert. Das Dossier wollte er sich jetzt nochmals genauer ansehen. Er holte seinen Laptop und öffnete das Dokument. Dann stockte sein Atem: Lobi4.docx, last modified March 3, 2014, 17:36 – heute war der zehnte! Seine Uhr und der Computer waren sich darin einig.
Keller stützte die Ellbogen auf den Tisch und vergrub den Kopf in die Hände. Er versuchte, sich zu erinnern, wie er die verlorene Woche verbracht hatte – nichts! Es war, als ob er in ein schwarzes Loch starrte. Er konnte sich genau erinnern, wie er gestern – oder vor einer Woche – nach einem bescheidenen Imbiss überlegt hatte, ob er einen Abendspaziergang unternehmen sollte. Dann musste er eingeschlafen sein. Vielleicht war er im Halbschlaf ins Bett gekrochen und hatte sieben Tage durchgeschlafen. Das war zwar nicht wahrscheinlich, aber die einzige Erklärung, die ihm einfallen wollte.
Schon früher hatte er derartige Absenzen erlebt – oder vielmehr nicht erlebt. Meistens erstreckten sie sich bloss über einen oder zwei Abende. Nein, wenn er ehrlich war, fehlten manchmal auch ganze Tage. Irgendwie hatte er solche Episoden jeweils verdrängen können. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als es auch diesmal wieder zu versuchen.
Er fuhr auf. Beim Rasieren heute früh hatte er den Eindruck erhalten, sein Gesicht sei gebräunt. Er hatte angenommen, sein langes Verweilen auf der Terrasse habe seine Winterblässe vertrieben, obwohl er meistens unter dem Sonnenschirm gesessen war. Zudem hatte ihm der Elektriker versichert, die neue Beleuchtung im Badezimmer schmeichle dem Teint. Damit hatte er die Sache abgetan. Im Hinblick auf die entdeckte Zeitlücke wurde diese Erklärung weniger stichhaltig. Er versuchte sich vorzustellen, er sei in die Berge gefahren und habe vor einem Panorama weisser Bergketten auf einer Sonnenterrasse in einem bequemen Korbsessel ein Glas Weisswein getrunken. So sehr er sich auch Mühe gab, gelang es ihm nicht, sich davon zu überzeugen, dies wirklich erlebt zu haben. Keller rang nach Atem. Er musste aus seinen vier Wänden hinaus und sich irgendwie ablenken.
Mit eingezogenen Schultern hastete er über die Rathausbrücke in der Hoffnung, von keinem rotbehosten Kampfpiloten mit Schmerbauch belästigt zu werden. Nichts dergleichen geschah und er schlenderte etwas entspannter die Storchengasse hinauf und sah sich die Auslagen der Boutiquen an. Im Café Presse Club am Münsterhof waren alle Tische besetzt, und er ging weiter zum Hotel Metropol. Dort war das Bistro fast leer. So wagte er es einzutreten, wählte einen kleinen Tisch, machte es sich auf dem braunen Sofa bequem und hoffte, dass sich innerhalb der nächsten Stunde ein Kellner zu ihm verirren würde. Zu seinem Erstaunen wurde er sofort bedient.
Vorsichtig nippte er an seinem Riesling-Silvaner und versuchte vergeblich, seinen Schreck zu vergessen. Er nahm die NZZ vom Nebentisch und blätterte darin. Er las sonst ziemlich regelmässig die zahlreichen Zeitungen, die im «Presse Club» auflagen. So war ihm der Volksaufstand in der Ukraine nicht neu, doch während seiner «Abwesenheit» war einiges geschehen. Die pro-westlichen Aufständischen hatten sich durchgesetzt und forderten bereits das Verbot der russischen Sprache, was die Westmächte anscheinend nicht störte – wenn sie bloss ein weiteres Gebiet der ehemaligen Sowjetunion unter ihren Einfluss bringen konnten. Im Gegenzug benutzten die Russen dies als Ausrede, sich die Krim unter den Nagel zu reissen. Angewidert drehte er die Seite um. Das Geläster zweier Politiker über unverantwortliche Kolleginnen, die landesverräterisch gegen den Kauf des neuen Kampfjets Gripen auftraten, war auch nicht geeignet seine Stimmung aufzuhellen.
Entmutigt schmiss er das Blatt auf den Tisch, nippte an seinem Glas und dämmerte vor sich hin, bis eine ältere Dame und ihr bedeutend jüngerer Begleiter am Tisch gegenüber Platz nahmen. Er konnte nicht umhin, sie ein wenig zu beobachten. Das waren bestimmt Mutter und Sohn. Diese Annahme bestätigte sich, als der junge Mann die gebrechliche Dame mit Mami ansprach. Das hatte Seltenheitswert: Sohn führt seine Mutter in den Ausgang, ohne andauernd am Handy zu hängen. Er selbst hatte nicht die geringste Erinnerung an seine Kindheit. Seine Eltern hatte er nie gekannt. Er wusste bloss aus den Unterlagen zur Erbschaft, dass seine verwitwete Mutter ihm ein beträchtliches Vermögen hinterlassen hatte. Seine ganze Jugend war einem Filmriss zum Opfer gefallen. Was hiess da Riss? Die ganze Filmrolle war abhandengekommen.
Seine erste Erinnerung war, wie er in einer Vorlesung an der Universität sass, als ob der Storch ihn soeben dort abgesetzt hätte. Von da an hatte er eifrig studiert, sich kaum eine Abwechslung gegönnt und in Rekordzeit sein Doktorat in Kunstgeschichte gemacht. Um alte Inschriften lesen zu können, hatte er Latein als Nebenfach gewählt, was ihm jetzt erlaubte, gelegentlich an Mittelschulen zu unterrichten. Die Klassik hatte ihn jedoch wenig fasziniert. Sein Hauptinteresse galt von Anfang an der Stammeskunst, besonders der afrikanischen. Er verbrachte die ganze Freizeit in den Sammlungen des völkerkundlichen Museums der Uni, im Museum Rietberg, in Bibliotheken und besuchte Ausstellungen in der Schweiz und den umliegenden Ländern. Für diese Periode konnte er sich an alles lückenlos erinnern.
«Leider nicht alles …», knurrte er vor sich hin, «denk an die schwarzen Löcher.» Schon während der Studienzeit hatte er Momente von Abwesenheiten erlebt, die ein paar Stunden, manchmal auch Tage dauern konnten. Einmal hatte er eine Prüfung verpasst und nie herausgefunden weshalb. Es ging um eines seiner Lieblingsfächer, und er war gut vorbereitet. Der verständige Professor hatte ihm freundlicherweise einen andern Termin gegeben, und er hatte glänzend bestanden. Genau genommen fehlten ihm an den meisten Tagen ein paar Stunden, doch längere Lücken waren mit der Zeit selten geworden. Deshalb hatte er auf den jetzigen Aussetzer so panisch reagiert.
Читать дальше