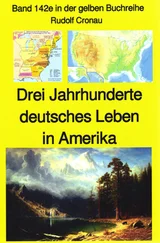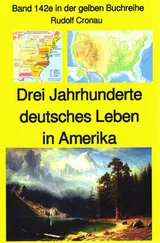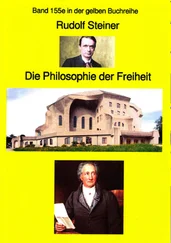1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Wir waren zu siebt unterwegs, fünf Musiker und zwei Techniker. Ich war zwar der Boss, aber ich wusste, dass die Band mit sanfter Gewalt von Hendrik Schaper geführt werden musste. Weder Mick noch ich konnten das. Hendrik zeigte uns, dass manche unserer Arrangements eben doch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern deutlich verbesserungswürdig waren. Aber auch die anderen in der Gruppe be- und verstärkten mich. Sie waren viel mehr als nur eine Begleitband. Obwohl im Lauf der Jahrzehnte die Liste meiner Musiker lang wurde, hat sich daran bis heute nichts geändert. Noch immer steht, wie schon im Winter 1981, auf den Tourplakaten nicht »Heinz Rudolf Kunze & Band«, sondern: »Heinz Rudolf Kunze & Verstärkung«.
Wir hatten längst nicht überall volle Säle. In Bielefeld spielten wir vor zwölf Leuten, in der Hamburger Markthalle dafür vor tausend. Aber wohin wir auch kamen, hörten die Menschen uns zu. Meine Ängste waren unbegründet gewesen. Ich konnte die Bühne tatsächlich zu meinem Ort machen. Zum ersten Mal merkte ich, dass Beifall eine Droge sein kann. Den Moment, in dem er zum ersten Mal laut gerauscht hat, vergisst man nie wieder. Damals hielt ich das auch für eine Gefahr, ich befürchtete einen Verlust der Unschuld. Würde ich von nun beim Schreiben meiner Lieder immer auf diesen Beifall zuhalten, in der Hoffnung, dass ich ihn wieder hörte, möglichst sogar noch heftiger? Das hat sich mittlerweile gelegt, und ich kann die Reaktionen des Publikums als Ansporn betrachten, als Traubenzucker, den man zu sich nimmt, um seine eigenen Möglichkeiten noch besser einschätzen und mit seinen Mitteln noch effektiver umgehen zu können. Wäre ich ein Schriftsteller, würde mir genau das unendlich fehlen.
Nur wenige Lieder erzählen direkt aus meinem Leben, man kann sie fast an einer Hand abzählen. Sie zu schreiben fiel mir nicht leicht. Nicht etwa, weil ich fürchtete, mich mit ihnen zu weit ins Offene hinauszuwagen. Sondern weil es mir entsetzlich eitel erschien, den Hörer mit meiner Person zu behelligen. Hatte ich mich aber einmal dazu entschlossen, blieb ich nicht auf halber Strecke stehen. Dann nahm ich die Maske ab und stürzte mich geradezu lustvoll ins Autobiographische. Ich hob die Hände und ergab mich. In diesen Liedern zeigten alle Pfeile auf mich selbst.
Eines hieß »Vertriebener«. Manchmal kündigte ich es in den Konzerten Mitte der achtziger Jahre als mein »Born in the U.S.A.« an. Springsteen hatte seinen Song etwa ein Jahr zuvor veröffentlicht, und viele, darunter Präsident Reagan, hielten ihn für ein patriotisches Glaubensbekenntnis reinsten Wassers. Die bombastische Musik scheint das zumindest nicht auszuschließen. Achtet man aber auf den Text, bleibt von Triumph nur Bitterkeit übrig. Springsteen formuliert die Klage eines Vietnam-Veteranen, von dem die amerikanische Gesellschaft nach seiner Rückkehr aus dem Krieg keine Notiz mehr nehmen will. »Born in the U.S.A.« ist ein Stück über den Verlust von Heimat. Darüber, wie es sich anfühlt, kein Zuhause zu haben und nicht zu wissen, wohin man noch gehen kann, wenn man alles verloren hat.
Schon mit der Titelformulierung »Vertriebener« bezog ich mich auf genau dieses Gefühl. Doch während Springsteen einen fiktiven Charakter entworfen hatte, erzählte ich aus meinem eigenen Leben. Ich hatte nie eine Heimat gehabt und würde auch niemals eine haben. Vielleicht war mir einmal eine zugedacht gewesen, nämlich diejenige meiner Eltern – dort, ganz im Osten, in der Niederlausitz, woher sie stammten, in der kleinen Stadt Guben an der Oder-Neiße-Grenze. Diese Heimat gab es ja auch noch, aber eben nicht für mich. Erst als Erwachsener habe ich Guben zum ersten Mal gesehen, ich bin als Fremder durch die Straßen gegangen. Auch meinen Eltern war diese Heimat längst nicht mehr zugehörig, zwischen ihnen und ihrer Heimat lagen Nazi-Zeit und Krieg, lagen die Gefangenschaft meines Vaters und seine Rückkehr, die erst erfolgte, als es schon zwei deutsche Staaten gab. Mein Vater hat sich für den Westen entschieden, meine Mutter ging mit ihm, sie hatte elf Jahre auf ihn gewartet.
Die Deutschen haben Millionen von Heimaten ausgelöscht, auch mein Vater war daran beteiligt. Dass er selbst seine Heimat verloren hat, kann nichts wiedergutmachen von dem, was nicht wiedergutzumachen ist. Nicht für die Ermordeten, nicht für die am Leben Gebliebenen und auch nicht für die erst später ins Leben Gekommenen.
Ich wurde geboren in einem Spätaussiedlerlager in Espelkamp-Mittwald, wo mein Vater eine erste Stelle nach seiner Heimkehr gefunden hatte, später zogen wir um, mal nach einem Jahr, mal nach einem halben. Ich lernte schon als Kind, dass es immer weiterging, ohne Grund und ohne Boden, wieder fort, auch von Orten, an denen ich mich wohl gefühlt hatte. Wir überlebten, und wir entfernten uns, und als meine Eltern endlich blieben und versuchten, Frieden mit der Welt zu schließen, in Osnabrück war das, hingen an den Wänden die Fotos und Bilder und Stiche von Frankfurt an der Oder, Cottbus und Guben. Sie führten ihr Leben wie auf Vorbehalt, denn eines Tages, wenn es die politischen Verhältnisse erlauben würden, würden sie ihr Exil verlassen und wieder zurückgehen, dahin, wo für sie noch immer Heimat war. Doch als schließlich der Tag kam, waren sie nicht mehr jung genug, um noch ein letztes Mal aufzubrechen, und die Verwandten im Osten Deutschlands lebten nicht mehr. Also blieben meine Eltern in Osnabrück, um dort irgendwann auch zu sterben.
Vom »festen Wohnsitz Osnabrück« sang ich in »Vertriebener«, von »Heimat« konnte ich nicht sprechen. Eine meiner Platten »4500 Osnabrück« zu nennen, weiße Kreideschrift auf grauem Grund, wäre mir unmöglich gewesen. Ich war nicht verwurzelt, ich hatte nur eine Herkunft. Mein Zuhause war überall dort, wo man mich sah und mir zuhörte. Ich war ein Vertriebener, aber wenn ich eines nicht wollte, dann Revanche. Nur Glück.
Eigentlich dachte ich, damit mein Anliegen hinreichend deutlich gemacht zu haben. Der Bund der Vertriebenen belehrte mich jedoch eines Besseren. Im Januar 1987 zeigte mir jemand vor unserem Auftritt in Minden einen Artikel aus der örtlichen Tageszeitung. Die Überschrift lautete: »Dank für ein klares Bekenntnis – Bund der Vertriebenen lobt Heinz Rudolf Kunze«. Ein plumper, lachhafter Versuch der Vereinnahmung. Diese Typen wollten nichts verstehen, verstanden auch nichts, aber das hatten sie ja noch nie. Ich nahm die Zeitung mit auf Tour und zeigte sie Abend für Abend dem Publikum. Die Leute johlten, als ich die Gelegenheit nutzte, um feierlich zu erklären, keine Ansprüche auf Gebiete jenseits meiner eigenen Haustür zu erheben. Den Dank der Vertriebenen wies ich höflich, aber bestimmt zurück. Konstantin Wecker wollte schließlich auch keinen Orden vom Bund der FKK-Freunde, nur weil er ein Stück mit dem Titel »Wenn der Sommer nicht mehr weit ist« im Repertoire hatte.
Wenn mich Journalisten auf »Vertriebener« ansprachen, interessierten sie sich besonders für die Zeile »Mein Vater war bei der SS«. Sie wollten wissen, ob ich auch da die Wahrheit sang. Das tat ich. Es stimmte. Die SS-Mitgliedschaft meines Vaters ist ein Riss in meinem Leben, der sich nicht schließen lässt. Vielleicht bin ich auch deshalb Sänger und Texter geworden, vielleicht ist mein zwölf Jahre jüngerer Bruder auch deshalb Historiker geworden, weil wir Antworten auf unsere vielen Fragen gesucht haben. Wir wollten verstehen, was genau geschehen war. Dazu mussten wir in der Lage sein, die Kriegszeit unseres Vaters zu rekonstruieren, ich mit den Mitteln der Kunst, mein Bruder mit den Methoden der Wissenschaft.
Nicht dass mein Vater selbst über seine Vergangenheit geschwiegen hätte. Er redete sogar sehr offen und viel darüber, er redete wie ein Wasserfall. Ich war fast noch ein Kind, als er damit begann, mich als Gesprächspartner ernst zu nehmen und in seine Erinnerungen mit einzubeziehen. Das machte mich stolz, gleichzeitig ließ mich vieles von dem, was er erzählte, fortan nicht mehr los. Das Schweigen der Väter, an dem so viele meiner Generation in ihrem Bemühen, Auskunft zu erhalten, verzweifelt sind, habe ich nie erlebt. Ich erfuhr alles. Ich erfuhr Banales, und ich erfuhr Unerträgliches. Oft war es mehr, als ich aushalten konnte. Wie etwa die Antwort meines Vaters – den ich ja liebte, wie es alle Kinder tun – auf meine Frage: »Hast du Menschen getötet?«
Читать дальше