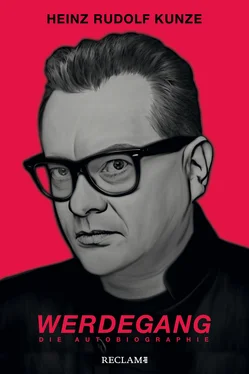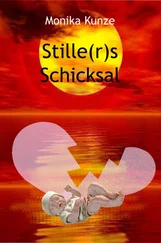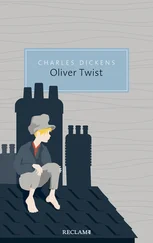Ich bestand die letzten Prüfungen an der Uni, dann fuhr ich nach Hamburg, um meine erste LP aufzunehmen. Keine Atempause. Die WEA hatte das Rüssl-Studio im Stadtteil Eidelstedt ausgesucht, es gehörte Otto Waalkes. Otto hatte sein Geld gut investiert und sich mit der Zeit ein wahres Rüssl-Imperium aufgebaut, zu dem auch noch ein Musikverlag, ein Plattenlabel und sogar ein mobiles Aufnahmestudio für Konzertmitschnitte gehörten. Während unserer Aufnahmen grüßte der Ottifant von allen Wänden, auch der Hausherr selbst ließ sich gelegentlich blicken, setzte sich zu uns, aber nur, um sofort wieder aufzuspringen, weiterzuhasten, zu telefonieren oder sonst irgendwelche Dinge zu regeln. Meist sahen wir nur seine wehenden blonden Haare. Quecksilber in Bewegung.
Ottos ehemaliger Mitbewohner aus der Villa Kunterbunt in Winterhude hatte mehr Sitzfleisch. Udo Lindenberg kam gleich mehrmals im Studio vorbei, nicht nur, um Billard zu spielen. Manchmal legte er sich auf die Couch und hörte uns blutigen Anfängern ein wenig zu. Höflich fragte er davor jedes Mal um Erlaubnis. Wir begegneten einem freundlichen, eher zurückhaltenden Mann, der es erst gar nicht zuließ, dass man sich in seiner Gegenwart gehemmt oder eingeschüchtert fühlte. Sein Interesse an dem, was wir taten, war echt, und was er zu unserer Musik sagte, vor allem zum Schlagzeug, hatte Hand und Fuß. Das war der andere Udo Lindenberg, der ohne Hut und Brille, ohne Udo-Slang, Udo-Gesten, Udo-Lebenswerk. Der, den die Öffentlichkeit kaum kannte, aber den zu erleben ich über die Jahre dann mehrere Male das durchaus aufwühlende Vergnügen haben würde, bei ausgeschalteten Kameras und Mikrofonen, in leisen Vieraugengesprächen. Dann zeigte sich Udo jedes Mal wie ohne Haut, fast lebensgefährlich verunsicherbar, und ich merkte, dass er den Gürtel, auf dem in großen Buchstaben ›Panik‹ stand, nicht grundlos trug.
Udo hatte mir und zahllosen anderen Kollegen vorgemacht, dass es tatsächlich möglich war, die kantige, knirschende, konsonantenreiche deutsche Sprache mit der biegsamen, vieldeutigen, groovenden Musik der Leute aus Liverpool und Memphis zu versöhnen. Dass so was ging. Vielleicht konnte ich mit einigen meiner Lieder sogar zeigen, dass es lief.
Für die Nachsicht, mit der er meine ersten, noch tapsigen Gehversuche begleitet hatte, konnte ich mich 1994 ganz offiziell bedanken. Zu einem Tribut-Album mit Udo-Songs steuerte ich die Liner Notes bei und eine Hochdruck-Version von »Odyssee«. Dass es die letzte Aufnahme vor der Trennung von meiner langjährigen Band sein würde, war zumindest schon zu ahnen. Ich sang Udos Worte vom klemmenden Kompass, vom Verlieren der Richtung und vom dichten Nebel, in dem die Zukunft lag, und kommentierte damit eigentlich auch unsere Situation als Band. Aber wir schafften es, noch einmal dem heraufziehenden Unwetter zu trotzen, ehe alles auseinanderflog. Udo gefiel unsere Fassung so gut, dass er sie an den Anfang des Albums stellte.
Ursprünglich hatte ich vorgehabt, im Rüssl-Studio mit den Musikern zu arbeiten, die auch schon bei der Aufnahme der Demos mit von der Partie gewesen waren. Hendrik Schaper, Joachim Luhrmann, Joshi Kappl. Und Mick natürlich, der zudem als Produzent vorgesehen war. Siegfried Loch sah das ein bisschen anders. Er mache mir gegenüber keinen Hehl daraus, dass er Mick die Produktion der Platte nicht zutraute. Er wollte jemanden mit wirklicher Erfahrung und einem höheren Bekanntheitsgrad. Er wollte einen Namen, der aufhorchen ließ und dem ganzen Unternehmen ein wenig mehr Glanz verlieh. Wie nicht anders zu erwarten, wurde er fündig. Klaus Voormann hatte nach Jahren in Los Angeles genug von der ewigen Sonne und war dabei, seine Zelte wieder in Hamburg aufzuschlagen. Loch wollte ihn mit der Produktion meiner Platte betrauen. »Voormann kann bei der Gelegenheit ja auch gleich seinen Bass mitbringen«, sagte er.
Gerade mal ein Vierteljahr war es her, dass ein durchgeknallter Fan John Lennon in New York erschossen hatte. Damals hatte ich die Nachricht im Radio gehört, und mir war im wahrsten Sinne des Wortes der Stift aus der Hand gefallen. Fürs Erste konnten mir alle Prüfungen gestohlen bleiben. Wie nahe mir Lennons Tod ging, zeigte wohl am besten Elke Bunnings Reaktion, als sie an jenem traurigen Dezembertag in mein Gesicht sah. Sie erschrak regelrecht.
Und nun sollte Lennons Freund Klaus Voormann, den alle nur den ›fünften Beatle‹ nannten, mein Produzent werden. Ich fühlte mich, als hätte man mich nachträglich in die von Voormann gestaltete Collage auf dem Revolver -Cover eingefügt. Ein langer Zug ikonischer Bilder setzte sich in mir in Bewegung, die ersten davon noch in Schwarz-Weiß, darauf ein paar junge Männer aus Liverpool im Nachkriegsdeutschland, auf dem Hamburger Dom, auf einem Güterwagen mit der Aufschrift »Hugo Haase Hannover«, sie sind zu fünft, Pete Best ist noch dabei und Stuart Sutcliffe noch am Leben, sie tragen Lederjacken und spitze Schuhe, und fotografiert werden sie von Astrid Kirchherr, Voormanns bester Freundin. Später dann, längst in Farbe, Voormann als Bassist auf der Bühne, in Toronto bei Lennons »Live Peace«-Gig, im Madison Square Garden bei Harrisons »Concert for Bangladesh«. Aber vor allem war Voormann der Bassist gewesen auf Plastic Ono Band , dem ersten Lennon-Soloalbum, das uns nackter als nackt mit Seelenschürfwunden-Songs das Ende des Traums verkündet und uns ins Weitermachen auf eigene Faust und Rechnung entlassen hatte. Die Vorwegnahme von Punk um mehr als fünf Jahre – und gleichzeitig schon sein einzig gültiger Schlussstein.
Klaus Voormann kam und entpuppte sich als gelassener, überaus zuvorkommender Hippie mit schon grauem Haar. Er roch den Braten schnell und hatte schon zu viel erlebt, um sich noch in Positionskämpfe verwickeln zu lassen. Zwar hatte Loch ihn als Produzenten geholt, aber wenn Mick das Feld nicht räumen wollte, und das wollte Mick auf keinen Fall, dann ließ Voormann ihn eben gewähren und spielte nur Bass. Kein Thema. Ungünstig nur, dass er ganz offensichtlich die Saiten seines Basses seit den Aufnahmen zu »Imagine« nicht mehr allzu oft gewechselt hatte. Wir sahen staunend, wie verrostet sie waren, und Thomas Kuckuck, der Toningenieur im Rüssl-Studio, musste die Regler schon ganz aufreißen, um überhaupt ein Bass-Signal empfangen zu können. So leise spielte Voormann, so wenig Druck übte er aus. Einige Spuren waren beim besten Willen nicht zu gebrauchen, und es war eine Fügung des Schicksals, dass eines Tages Joshi Kappl aus einem anderen Grund im Rüssl-Studio zu tun hatte. Wir behielten ihn gleich da. Für das Reparieren der Spuren brauchte er nur wenige Stunden.
Mein Glücksgefühl hielt sich trotzdem hartnäckig. Ich nahm mein Debütalbum auf, Klaus Voormann spielte auf einigen Stücken Bass, Otto Waalkes und Udo Lindenberg saßen im Aufnahmeraum und hörten zu! Eigentlich, so war ich mir sicher, war ich damit bereits ganz oben angelangt. Was sollte denn jetzt noch kommen?
Manche der Stücke, die wir aufnahmen, hatte ich bereits vor einigen Jahren geschrieben, mit siebzehn oder achtzehn, damals hatte ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Den alten Satz, wonach man für seine erste Platte ein halbes Leben Zeit hat, für die nächste aber nur ein Jahr, würde ich sicher nicht unterschreiben. Der in der Vergangenheit angelegte Vorrat an mir relevant erscheinenden Liedern war dafür einfach zu groß. Musikalisch bewegte sich die Platte zum allergrößten Teil innerhalb der Grenzen, die man für gewöhnlich einem Liedermacher zugestand. Sie klang nach Akustikgitarre und Klavier. Zu mehr als schüchternen Ausflügen ins Laute reichte es noch nicht, und auch die Flirts mit der Neuen Deutschen Welle blieben so dezent, dass man sie kaum bemerkte.
Anders verhielt es sich mit den Texten. Auf der Burg Waldeck würde man mit ihnen von der Bühne gejagt werden. Vorsichtshalber ließ ich einen Satz des rumänischen Philosophen Emil Cioran als Gebrauchsanweisung auf die Plattenhülle drucken: »Man kann jede Wahrheit ertragen, sei sie noch so zerstörerisch, sofern sie für alles steht und so viel Vitalität in sich trägt wie die Hoffnung, die sie ersetzt hat.« Ich wusste, dass einige von mir hochgeschätzte Kollegen aus Österreich ähnliche Exkursionen ins Düstere, Böse, Sarkastische, Morbide unternahmen. Bei Georg Danzer oder Ludwig Hirsch verhinderte jedoch ihr Schmäh, dass der Hörer völlig in den Abgrund stürzte. Der Schrecken kam stets mit ein wenig Schlagobers verziert daher. Bei den Preußen gab es das nicht. Die Wahrheit wurde pur serviert.
Читать дальше