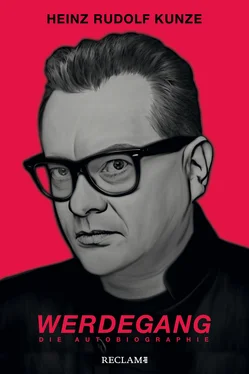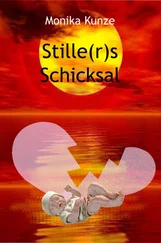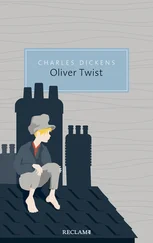Doktor Meyer hatte die ganze Zeit still zugehört. Jetzt sah er den Moment für seinen Auftritt gekommen.
»Aber Herr Direktor Ahlborn, bei allem Respekt, wir lassen uns doch nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Leuten vorschreiben, was wir hier veranstalten! Über unsere Unterrichtsinhalte entscheiden immer noch wir! Herr Kunze hat diesen Roman ausgewählt, ich habe das begleitet, und an seinem Unterricht gibt es nicht das Geringste auszusetzen. Wer sind wir denn, dass wir vor solchen Querschüssen in Deckung gehen!«
Der Direktor dachte einen Augenblick nach, dann straffte er sich.
»Stimmt, Herr Doktor Meyer, da haben Sie eigentlich recht. Machen Sie weiter, Kunze!«
Und so kam es, dass eine große Koalition aus CDU und SPD für Rolf Dieter Brinkmanns Keiner weiß mehr Partei ergriff. Noch Jahre später sprachen mich nach Konzerten ab und zu einige meiner ehemaligen Schülerinnen an. Keine hatte auch nur im Geringsten durch die Lektüre des Romans Schaden genommen.
Im Frühsommer 1980 saß ich vor dem Radio und hörte NDR. Ich war den Sendungen von Klaus Wellershaus verfallen, seit ich begonnen hatte, mich ernsthaft für Musik zu interessieren. Doch an diesem Tag kam es mir zum ersten Mal so vor, als würde sich Wellershaus wie in einer öffentlichen Durchsage an mich persönlich wenden. Er sprach von einem anstehenden Pop-Nachwuchsfestival der Deutschen Phonoakademie, von einer hochkarätig besetzten Jury und von Stipendien, Preisen und sogar Plattenverträgen, die winkten. Die Endausscheidung werde an drei aufeinanderfolgenden November-Tagen im Würzburger Stadttheater stattfinden. Also schickt eure Kassetten, sagte Wellershaus, aber denkt daran: Kein Beitrag darf länger als fünfzehn Minuten sein. Und weiter ging es mit Musik.
Ich starrte das Radio an. Ein Nachwuchsfestival! Auf so eine Idee war ich in all der Zeit gar nicht gekommen. Aber war es nicht sowieso schon viel zu spät, sich noch einmal Hoffnungen zu machen? Eigentlich hatte ich doch den Traum, mein Leben der Musik zu widmen, nie richtig zu träumen gewagt. Alles stand schon fest, so wie immer alles in meinem Leben schon festgestanden hatte. Die Zukunft würde nichts als die Fortsetzung der Gegenwart sein. Meine Wege würden nicht erst beim Gehen entstehen, sondern schon ausgeschilderte sein, wohin ich auch kam.
Aber Wellershaus hatte so überzeugend und auch so ermutigend geklungen. Mit seinem Hinweis auf das Festival hatte er unversehens eine Tür geöffnet, die ich nicht einfach wieder zufallen lassen konnte, ohne zumindest probiert zu haben, hindurchzugehen. Alleine würde mir das jedoch nicht gelingen. Ich rief Mick an, er war sofort bei der Sache. Seine Unbekümmertheit sprang auf mich über. Was konnten wir schon verlieren? Bei Mick nahmen wir zwei meiner Songs auf, beide hatten so viel zu erzählen, dass ein dritter den vorgegebenen Zeitrahmen gesprengt hätte. Als ich die Kassette zur Post brachte, war ich mit mir selbst im Reinen. Wir hatten unser Bestes gegeben, mehr konnten wir nicht tun. Außer zu warten.
Die Einladung nach Würzburg kam per Telegramm. Mick und ich waren für die Endausscheidung im Bereich ›Folk-Lied-Song‹ ausgewählt worden. Daneben gab es auch noch die Bereiche ›Rock‹ und ›Jazz‹, insgesamt hatten sich, so hörte man, mehrere hundert Solisten und Bands beworben.
Als wir am 9. November 1980 im Stadttheater ankamen, platzten wir mitten in den Aufbau einer anderen Band. Beinahe konnte man meinen, Pink Floyd hätten sich nach Würzburg verirrt. Angesichts der Keyboard-Türme, Gongs und Marshall-Stacks kamen wir uns mit unseren beiden Wandergitarren wie eine Abordnung der lokalen Pfadfindergruppe vor. Wie ich später von meinem ersten Bassisten Joshi Kappl erfuhr, stammten die Musiker von Transsylvania Phoenix ursprünglich aus Rumänien, waren aber in einer spektakulären Aktion in den Westen geflohen, weil sie die Restriktionen durch das Ceaușescu-Regime nicht mehr ausgehalten hatten. Doch sie mussten schnell erkennen, dass ihr auf Englisch vorgetragener, mit Folk-Elementen versetzter Prog-Rock, mit dem sie in Rumänien Stadien gefüllt hatten, in den Zeiten von New Wave und Punk antiquiert wirkte. Sie waren zu spät gekommen. Nun versuchten sie ihr Glück beim Nachwuchswettbewerb, jedoch ohne Joshi Kappl, der fürs Erste bei der Band ausgestiegen war. Wir sollten uns erst ein paar Wochen später über den Weg laufen, dann aber für viele Jahre gemeinsam tätig sein.
Für alles auf Deutsch Gesungene abseits des wie eh und je populären Schlagers standen Ende 1980 die Sterne dagegen günstig. So günstig wie vielleicht noch nie. Angesichts der sich aufbauenden Neuen Deutschen Welle lag bei den Plattenfirmen Goldgräberstimmung in der Luft. Eine mehr oder weniger freundliche Übernahme des musikalischen Untergrunds durch die Industrie stand unmittelbar bevor. Doch noch passten unter den Oberbegriff ›NDW‹ jede Menge Widersprüche: Coolness und Weltschmerz aus grauer Städte Mauern; Neo-Schlager und Zackig-Dadaistisches. Auf einmal gab es nicht mehr nur die Liedermacher oder Rock-Einzeltäter wie Udo Lindenberg und Ton Steine Scherben. Sondern auch Bands wie Fehlfarben, Ideal und DAF, deren erste Platten mich elektrisiert hatten. Dass ich zumindest indirekt einmal von ihren Pioniertaten profitieren würde, wäre mir jedoch nie in den Sinn gekommen. Aber genau so war es. Die Zeit war reif für sperrige deutsche Texte. Der Zufall hatte mich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geführt.
Unsere ›Folk-Lied-Song‹-Mitbewerber in Würzburg hielten der Tradition noch unverbrüchlich die Treue. Ihre Stücke hießen »Flieg, Vogel, flieg« oder »Mit dir zu fliegen«. Die inzwischen längst international bekannte, sogar Grammy-nominierte Cellistin Anja Lechner stimmte zusammen mit dem Pianisten Peter Ludwig ein seltsames Duett namens »Kieselsteine« an: »Ich möchte gern ein Kieselstein in deinem Bachbett sein …«. Eine Band hieß Fundevogel, eine andere Bundschuh. Mit derlei Empfindsamkeit konnte ich nicht dienen. Zwar hätte Mick mit seinen Ketten, seiner Weste über dem weiten weißen Hemd und seinem Vollbart problemlos in jeden Folk-Club gepasst. Aber mein Outfit wäre dort definitiv fehl am Platz gewesen. Ich wollte so aussehen wie Robert Fripp von King Crimson, nachdem er sich die Haare abgeschnitten hatte. Akkurater Scheitel, weißes Hemd, weiße Jeans, rote Chucks, und meine Kassengestell-verdächtige Brille trug ich ja ohnehin. Dazu wählte ich eine schwarze Krawatte. Leider hatte ich übersehen, dass das Fripp’sche Modell schmal geschnitten und aus Leder war. Ich hingegen betrat die Bühne mit einer ganz breiten, mir heute noch peinlichen Konfirmationskrawatte.
Durch den Abend führte Bill Ramsey. Ein freundlicher, jedem Auftretenden Mut zusprechender Mann, den man wohl für immer mit seinen Schlagern aus den sechziger Jahren verbinden würde, obwohl seine ganze Liebe dem Jazz gehörte. Ramsey sagte uns an, Mick und ich nahmen Platz auf zwei Barhockern, und unsere Viertelstunde begann. Wie auf der eingeschickten Kassette legten wir los mit »Balkonfrühstück«. Das Lied kann einen auf dem falschen Fuß erwischen, und genau das war mein Plan. Wer aufgrund des Titels und der beschwingten Melodie die Beschreibung eines Idylls erwartet, wird nicht glücklich werden. »Balkonfrühstück« ist ein Reiseführer in die seltsame Welt der Stadtränder, Reihenhäuser und Industriebrachen. Deutlich mehr »Highway 61« als ein Bild von Manet. Geschrieben hatte ich das Stück in einem Vorort von Nürnberg, genauer gesagt in Nürnberg-Langwasser, ein Freund wohnte da, den ich von der Studienstiftung kannte. Gila und ich hatten ihn über Ostern besucht, und ich war so fasziniert gewesen von seinen Trabantenstadt-Erzählungen, dass ich mir Notizen gemacht hatte. Wieder daheim, musste ich ihnen nur noch eine zusätzliche Drehung ins Absurde geben, und fertig war das Sittenbild eines Pfingstmontags im »Gewerbegebiet Nürnberg-Süd«, beschädigtes Leben und Geschichtsvergessenheit in unmenschlicher Architektur inklusive. Wie erhofft gefiel dem Würzburger Publikum der lokale Bezug. Ich hörte es lachen bei der Zeile »Wenn du dich anstrengst, kannst du durch den Frankensmog ein bisschen Sonne sehn« – da wusste ich, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt hatten.
Читать дальше