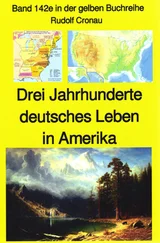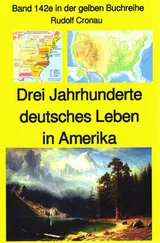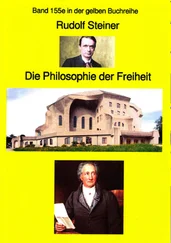1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 »Natürlich«, sagte er, »viele.« Er habe doch in der HKL gelegen, in der Hauptkampflinie mit direktem Feindkontakt, und da schieße man nun mal auf Leute, die einem entgegenrennen, das Gewehr im Anschlag.
Wie umgehen mit all den Erzählungen von der Ostfront? Erzählungen von seinem besten Freund, den mein Vater nach der Rückkehr von der nächtlichen Patrouille erstochen vorfand, Partisanen hatten ihm eine Heugabel in den Hals gerammt. Erzählungen vom Liegen in glühender Hitze, hier die Deutschen, dort die Russen, dazwischen die im Stacheldraht hängenden Leichen, sie wurden zerschossen, um den Gestank loszuwerden. Diese und noch andere Bilder, solche vielleicht, die er selbst mir verschwieg, sah mein Vater nachts im Schlaf, unzählige Male habe ich ihn schreien gehört.
In einem Buch hat mein Bruder den Weg unseres Vaters bei der SS-Division »Totenkopf« lückenlos nachverfolgt. Das Studieren der Quellen brachte die Gewissheit, dass er uns nicht belogen hatte. Im Gegensatz zu anderen seiner Division hat mein Vater nie in einem KZ Dienst getan. Aber wir sahen natürlich, in welchem Umfeld er sich bewegt hat und dass es auch leicht anders hätte kommen können. Nicht nur, weil Theodor Eicke, der frühere Kommandant von Dachau, Kommandeur seiner Division gewesen ist. Mein Vater hat auch Amon Göth gekannt, den grausamen Schlächter und KZ-Kommandanten, dessen Geschichte in Schindlers Liste erzählt wird. Doch damit rückte er erst heraus, als ich mich mit ihm über den Film unterhielt. Es schien ihm peinlich zu sein, zusammen mit Göth die Offiziersausbildung durchlaufen zu haben. Entgegen seiner sonstigen Art blieb er kurz angebunden. Göth hätten damals schon alle für verrückt gehalten, murmelte er nur, der sei für die kämpfende Einheit sowieso nicht zu gebrauchen gewesen. Dann wechselte er das Thema.
Mein Vater war ein Frontsoldat, man hat ihn sogar dekoriert. Er war so etwas wie ein Held, jedoch einer für die Falschen, für die ganz Falschen. Er wusste es, er hat es mir oft gesagt. Er wusste um die Sinnlosigkeit all der Jahre, die er verloren hatte, im Krieg, in der Gefangenschaft, und mein Bruder schreibt in seinem Buch, dass es wohl vor allem Trauer gewesen ist, die zwar nicht die Gegenwart meines Vaters, aber doch seine Erinnerungen beherrscht hat. Trauer über ein Leben, das nach allem, was gewesen war, kein wirklich glückliches mehr werden konnte, nicht für ihn, nicht für meine Mutter. Wie auch?
Ich vermag mir das Leben meiner Eltern, als sie noch nicht meine Eltern waren, kaum vorzustellen. Im Kopf lege ich die Strecke zurück, die immer weiter nach Osten führt, von Berlin sind es hundert Kilometer, bis man in Guben ist, wo sie aufgewachsen sind und zu Hause waren. Aber ich komme nicht dort an, ich schaffe es nicht, den Abgrund, der mich vom Leben derer trennt, die vor mir kamen, wirklich zu überqueren. Meine Eltern als junge Leute – was mochten sie gedacht und gefühlt haben? Als Hitler an die Macht kam, waren sie im Grundschulalter, ihre Erinnerungen an ein Davor, wie immer dieses Davor auch ausgesehen haben mag, dürften vage gewesen sein. Sie kannten doch nur ihre Gegenwart. Zwei Heranwachsende in einer Stadt mit 50 000 Einwohnern, zwei Heranwachsende in der Diktatur, später haben sie nicht gezögert, ihre Kindheit und Jugend als glücklich und behütet zu bezeichnen. Die Nachrichten, die sie erreichten, waren die offiziellen der Machthaber, und wenn meine Eltern sich umsahen in ihrem jungen Leben, hatten sie keinen Grund, der staatlichen Propaganda zu misstrauen, sie hätten ja nicht einmal zu sagen gewusst, was Propaganda überhaupt ist. Ich hatte keinen Grund, meinen Eltern nicht zu glauben, wenn sie vom Alltag in Guben erzählten, den sie auch später nicht mit den Gräueltaten des NS-Regimes zusammendenken konnten. Sie haben keine Hetze, keine Übergriffe beobachtet, keine nächtlichen Abtransporte, keine Verschleppungen, keine brennende Synagoge. Bis der Staat nach ihnen die Hand ausstreckte, verlief das Leben von Gerda Lehmann und Rudi Kunze, wie wohl ganz sicher auch meines an ihrer Stelle verlaufen wäre: unauffällig.
Zu Hause bewegten sie sich in gewöhnlichen Verhältnissen. Arthur Lehmann, der Vater meiner Mutter, arbeitete als einfacher Handlungsgehilfe, ich habe ihn nie kennengelernt. Die Eltern meines Vaters besuchten wir regelmäßig in den Schulferien, sie waren nach Schöneiche bei Ostberlin gezogen, dort ging alles langsam vonstatten, viel langsamer, als ich es von Osnabrück, gewiss keiner hektischen Metropole, kannte. Ich staunte über die Pferdefuhrwerke, die man dort noch sehen konnte, Geklapper der Hufe auf Kopfsteinpflaster, abends wurden Gaslaternen angezündet. Oma Röschen, pfiffig, freundlich, liebte mich heiß und innig, und ich liebte sie. Opa Erich, der in Guben eine Kohlenhandlung betrieben hatte, sah Adolf Hitler noch immer auffällig ähnlich, und das nicht nur aufgrund des Bärtchens. Meine ganze Existenz, meine Kindheit, die schon auf Wörtern und Tönen aufgebaut war, schien ihn persönlich zu kränken, weil sie seinem Ethos des Anpackens widersprach, und das ließ er mich spüren, indem er mich kränkte: »Rudi«, sagte er zu meinem Vater, »mit dem da kann ich nichts anfangen, der hat keine Schwielen an den Händen.« Ich habe ihm diesen Satz nie verziehen.
Meine Eltern lernten sich schon früh kennen. Guben war klein, und ihre Interessen und Begabungen im Bereich der Musik und des Theaters hatten sie in die sogenannte Spielschar der Hitlerjugend geführt. Auf dem Programm standen Gesang und Laienspiel, die Indoktrination erfolgte über die völkisch grundierten Inhalte der Lieder und Theaterstücke. Als Zuschauer waren vor allem Soldaten vorgesehen, die Spielscharen sollten sie bei Laune halten, Baldur von Schirach, der Reichsjugendführer, hatte sich das ausgedacht. Eine solche Truppenbetreuung führte meine Eltern im Juli 1942 nach Warschau. Es gibt ein Foto, darauf sind Gerda Lehmann und Rudi Kunze inmitten ihrer Gruppe zu sehen, zehn Jugendliche, vielleicht fünfzehn, alle tragen Uniform, und sie stehen am Zaun des Warschauer Ghettos, blicken hinein, keiner scheint etwas zu sagen in dem Augenblick, als der Fotograf auf den Auslöser drückt. Eine Erzählung meiner Mutter offenbart das, was auf dem Bild nicht zu sehen ist, vermutlich auch nicht zu sehen sein sollte. Sie habe, so sagte sie es mir, den HJ-Führer an diesem Juli-Tag nach den Menschen hinter dem Zaun gefragt, was machen die denn da, die liegen ja auf der Straße. Ach, die schlafen nur, sei die Antwort gewesen. Vielleicht wurde sie sogar geglaubt, weil sich die Wahrheit für die Jugendlichen damals jenseits des für sie Denkbaren befand.
Ich habe Günter Grass nicht verdammen können, als er 2006 seine Mitgliedschaft bei der Waffen-SS beichtete. Grass war siebzehn gewesen, als man ihn eingezogen hatte. Die nun über ihn herfielen, ihn mit Schimpf und Schande aus dem Literaturbetrieb ausschließen wollten oder gar die Rückgabe des Nobelpreises forderten, Journalisten, Politiker, sprachen ihr Urteil mit einer Selbstgerechtigkeit, die mich schaudern ließ. Heute fiele die öffentliche Empörung wohl noch um ein Vielfaches heftiger aus, sie würde sich in Windeseile durch die sogenannten sozialen Medien verbreiten, geifernd, unersättlich, nicht eher Ruhe gebend, bis der Abweichler von der zur Norm erhobenen eigenen Linie des Denkens, Sagens und Handelns für immer mundtot gemacht wäre. Bibelzitate gegen Cancel Culture zu setzen mag anachronistisch wirken. Wahr bleibt die Aufforderung, nicht zu richten, damit man selbst nicht gerichtet werde, dennoch. Jeder der Nachgeborenen, denen heute moralische Urteile so vehement und schnell über die Lippen kommen, sollte sich erst einmal selber fragen, wie er wohl gehandelt hätte, als Jugendlicher, im Krieg.
Meine Mutter war eine glänzende Schülerin, das habe ich von ihr geerbt. Meinem Vater jedoch fiel das Lernen schwer, so schwer, dass Klasse für Klasse seine Angst zunahm, das Abitur nicht zu bestehen. In der Oberstufe kamen die Werber der SS in die Schule, Himmler brauchte Nachschub, zu groß war der Blutzoll an der Ostfront. Nur noch die ganz Jungen waren zum Rekrutieren übriggeblieben, und gelockt werden sollten sie mit dem Geschmack von Freiheit und Abenteuer sowie der Aussicht, ohne großartige Prüfungen das Abiturzeugnis erhalten zu können. Mein Vater interessierte sich nicht für Politik oder für die Rassenideologie. Sicher war er, so wie die allermeisten, durchaus empfänglich für die Parolen von Führer, Volk, Vaterland und gerechtem Krieg. Aber das allein hätte ihn vielleicht nicht dazu gebracht, den Lockrufen der Werber zu folgen. Dazu brauchte es schon die ganz konkrete Sorge, in der Schule zu versagen. Mit sechzehn meldete er sich freiwillig, als er siebzehn war, einige Monate später, erhielt er seine Einberufung. Nach den Sommerferien 1942 ging es für ihn nicht mehr zurück ins Klassenzimmer. Seine Division, das III. SS-Ersatzbataillon »Totenkopf«, war in Mähren stationiert, in der tschechischen Stadt Brünn. Für den Weg dorthin zog sich mein Vater seine beste Kleidung an. Ein Jugendlicher im schon ein wenig zu klein gewordenen Konfirmationsanzug, der aus Angst vor dem Abitur der SS in die Arme lief.
Читать дальше