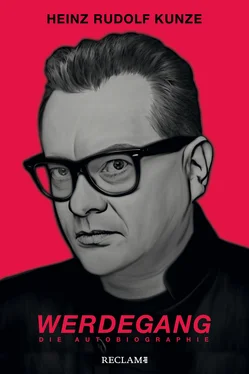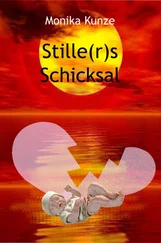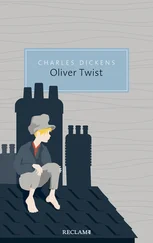Einerseits hatte er eine regelrechte Abscheu gegen alle Formen der SS-Traditionspflege, andererseits hielt er manchmal an äußerst zweifelhaften Leuten fest, weil er mit ihnen Jahre in einem sibirischen Lager verbracht hatte. Mir fällt der alte Nazi ein, der nach der Gefangenschaft sofort wieder auf die Füße gefallen war und es, auf welche Art auch immer, zu einer großen Ferienhaussiedlung an der Costa Brava gebracht hatte. Wir waren sogar einmal dort, er hatte uns eingeladen, ich studierte schon und hatte ihn nie zuvor gesehen, wusste aber sofort Bescheid, als er versuchte, mich für die Redaktion irgendeines braunen Blättchens anzuwerben: Sie können schreiben, Heinz Rudolf, höre ich. Kommen Sie doch zu uns, wir brauchen Leute wie Sie …
Ein anderer Besucher in Osnabrück trieb meinen Eltern den Schweiß auf die Stirn. Sie ließen ihn dennoch herein, einen kleinen, schattenhaften, verhuschten Mann von osteuropäischem Aussehen, einen Ukraine-Deutschen, auch ihn kannte mein Vater aus der Gefangenschaft. Gleich nach dem Überfall auf Russland hatte er sich auf die Seite der Deutschen geschlagen, ein Schreiber und Dolmetscher, den man offensichtlich bei Verhören, Folterungen und Erschießungen gut hatte gebrauchen können, so viel Ordnung musste schon sein. Auch beim Massaker von Babi Jar 1941 tat er seine schrecklichen Dienste. Dann, während der Gefangenschaft, gelang es ihm, weiß der Teufel, wie er es angestellt hat, seine Identität und damit auch seine Taten geheim zu halten. Man entließ ihn in die Freiheit, nun lebte er in Osnabrück und arbeitete, ich mag es kaum aussprechen, bei den örtlichen Gaswerken. Zu meinem Vater war er gekommen, weil er Hilfe suchte oder vielleicht auch nur ein offenes Ohr, denn er hatte panische Angst, vom israelischen Geheimdienst aufgespürt und entführt zu werden. Was mein Vater ihm sagte, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er nie wiederkam.
Am schlimmsten von allen aber war der Schwiegersohn eines Großonkels. Leider wohnte er, anders als unsere sonstige Verwandtschaft, mit Frau und Tochter in der Nähe und musste daher des Öfteren am Sonntagnachmittag besucht werden. Es war schließlich Familie, meine Mutter ließ da auch nicht mit sich reden, obwohl mein Vater sie mehrfach anflehte, endlich den Kontakt abzubrechen. Dieser Mann war Ausbilder bei der Luftwaffe gewesen, er hatte die gesamte Kriegszeit in der Etappe verbracht, auf einem kleinen Militärflugplatz in der Mark Brandenburg und damit fernab jeder Kampfhandlung. Er sprach von der Nazizeit und dem Krieg wie von einem Erholungsurlaub. Wann immer mein Vater ihm widersprach und von seinen schrecklichen Erlebnissen an der Ostfront oder in der Gefangenschaft erzählte, hieß es: Markier hier nicht den dicken Mann, du übertreibst doch, es war eine tolle Zeit, erzähl uns bloß keine Märchen. So ging es jedes Mal, bis mein Vater nach dem achten Cognac schließlich in Tränen ausbrach und sich ins Nebenzimmer zurückzog, wo ihn meine Mutter wieder aufrichten musste. Um den nächsten Verwandtschaftsbesuch kam er trotzdem nicht herum.
Meine Eltern haben mich sehr geliebt, daran gibt es keinen Zweifel. Sie taten es mit einer fast berserkerhaften Zuwendung. Ich kam auf die Welt als ein verzweifelt erwartetes Wunschkind, beladen mit den Hoffnungen auf ein Glück, das ihnen selbst verwehrt geblieben war. Ich sollte es einmal besser haben als sie. Oft kam es mir so vor, als verzichteten sie dafür auf ein eigenes Leben, aber vielleicht besaßen sie ja auch schon lange keines mehr, weil es ihnen gestohlen worden war, von dem ganzen verdammten Elend, das sie erfahren hatten und das nicht mehr vergehen wollte. Die Vorstellung meiner Eltern von Glück beschränkte sich auf das, was der Krieg ihnen davon übriggelassen hatte, sehr viel mehr, als sich wegzuducken und die Zähne zusammenzubeißen, war das nicht. Zu überleben, darum ging es.
Meine Eltern waren Gezeichnete, Traumatisierte. Und obwohl es oft nicht so aussah, weil der Alltag eben weiterging, die Arbeit, das Fernsehen, Geburtstage, Weihnachten, ist es ihnen nie gelungen, aus dieser Nacht aus Panik noch einmal herauszufinden, in die sie als junge Menschen hineingeraten waren. Einmal hatte ich einen Wutausbruch und warf ihnen vor, gar nicht wirklich in der Gegenwart zu leben, meinen kleinen Bruder und mich überhaupt nicht wahrzunehmen, eigentlich seien wir beide doch überflüssig, sagte ich, ihr hängt doch sowieso in der Vergangenheit fest und betrachtet den Rest nun als eine Zugabe, mit der ihr heillos überfordert seid.
In unserer Familie blieb die Angst vor einer Wiederkehr des Schreckens immer präsent. Jede Schlagzeile von einem bewaffneten Konflikt, und sei er noch so weit entfernt, ließ besonders für meine Mutter das ohnehin fragile Gleichgewicht ihres Alltags ins Wanken geraten. Für sie war der Krieg nicht vorbei, er machte nur eine Pause. Sie traute dem Frieden nicht und glaubte nicht an seinen Bestand. Jedes Politikerinterview konnte sie in Alarmstimmung versetzen. Sie führte ein Dasein auf Vorbehalt. Besitz stand sie misstrauisch gegenüber, sie konnte sich nicht am Haben erfreuen, sondern dachte bereits an den Verlust, der unweigerlich kommen würde. Es war aussichtslos, meine Eltern zum Kauf eines Häuschens, zumal auf Kredit, überreden zu wollen. Ich gab meinen Versuch schnell auf. Sie machten keine Schulden, weil sie schon damit rechneten, sie nie wieder tilgen zu können.
Die Daseinsangst äußerte sich bei meiner Mutter über Jahrzehnte hinweg auch körperlich, als Migräne-Attacken. Dann lag sie im Bett, den Kopf umwickelt mit nassen, heißen Tüchern, jedes Geräusch verstärkte die Schmerzen, wir schlichen auf Zehenspitzen durch die Wohnung, um sie nicht zu stören. Ab und zu hörten wir sie das Bett verlassen, sie ging auf die Toilette, mit halb geschlossenen Augen, ein Geist, taumelnd, nicht mehr in der Lage, etwas wahrzunehmen. Sie stieß sich am Anblick der Welt, sogar mich sah sie dann nicht mehr.
Auch das Leben meines Vaters war grundiert von Traurigkeit. Und doch ist es kein Widerspruch, wenn ich sage, dass er gerne gelacht und Unsinn getrieben hat. Er hielt am Traum, ein Entertainer wie Peter Frankenfeld zu sein, auch dann fest, wenn das Publikum nur aus uns, seiner Familie, bestand. Beim größten Fußballspiel aller Zeiten, Deutschland gegen Italien 1970 in Mexiko-Stadt, schlug er bei den deutschen Toren vor Freude Purzelbäume auf dem Wohnzimmerteppich. Er trank gerne und viel Alkohol, manchmal auch sehr viel, einen halben Kasten Bier und eine Flasche Weinbrand an einem Tag, doch nie habe ich ihn betrunken oder verkatert erlebt. Der Alkohol schien ihm einfach nichts anhaben zu können. Dabei achtete er nicht einmal auf Qualität. Statt sich einen guten und damit teuren Cognac zu leisten, kaufte er sich lieber vier Billig-Flaschen, von denen man halb blind wurde, wenn man sie nur ansah. Eine ganz besondere Vorliebe hegte er für Pennypacker-Whisky aus dem Discounter. Auf dem Etikett stand zwar »Bourbon«, aber der Geruch erinnerte eher an Möbelpolitur. Dafür stimmte der Preis, und die Flasche war groß. Ist doch ein Schnäppchen, Junge!
Vielleicht trank er auch nur, weil er hoffte, so für einen Augenblick das Versprechen vergessen zu können, das ihm mein Opa Arthur, der Vater meiner Mutter, auf dem Sterbebett abgenommen hatte: Rudi, du musst dich um Gertrud kümmern, jetzt, wo ich’s nicht mehr kann. Und Rudi versprach es ihm. Er war von da an verantwortlich nicht nur für seine Frau, sondern auch für seine Schwiegermutter, die bei jedem Ortswechsel mitkam, in jede Wohnung mit einzog.
Meine Oma Gertrud war die lebensunkundigste Frau, die ich je kennengelernt habe. Noch viel mehr als meine Mutter fürchtete sie sich vor der Welt. Sie hatte buchstäblich Angst vor allem. Sie las keine Zeitung, sie hörte kein Radio, und wenn die Nachrichten im Fernsehen anfingen, verließ sie das Zimmer. Sie liebte ihre Familie und vor allem mich abgöttisch, ansonsten aber war sie menschenscheu und hatte weder Bekannte noch Freunde. Einer der wenigen Fremden, mit denen sie überhaupt ein Wort wechselte, war der Fleischer, er kam aus derselben Gegend wie sie und sprach dasselbe starke Niederschlesisch.
Читать дальше