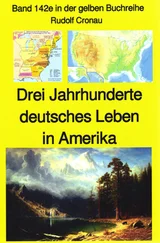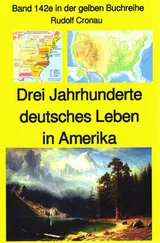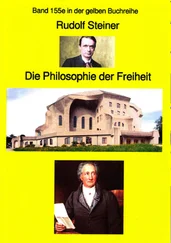Als wir von Alte Piccardie fortgingen, brach es mir das Herz. Wegen eines hartnäckigen Ziehens im Hals hatten mich meine Eltern von einem Arzt untersuchen lassen. Der sprach von einem Nervenleiden, warnte vor dem angeblich so schädlichen Moorklima und riet zum Umzug. Meine Eltern gehorchten, meine Mutter schien sogar ganz froh zu sein, auf diese Weise ihrer Eifersucht auf Alide Serwatka entkommen zu können. Nun würde sie mich wieder nur noch mit meiner Oma teilen müssen. Ich habe niemals einen Kindergarten von innen gesehen.
Wir landeten vom Himmel in der Hölle. Wir landeten in Bad Grund im Westharz, wo sich mein Vater auf eine Lehrerstelle beworben hatte. Der Ort lag in einer Schlucht, in die selbst an klaren Tagen kaum Sonne fiel. Die Leute begegneten uns mit unverhohlener Ablehnung. Mit uns im Zweiparteienhaus wohnte eine Familie, deren zwei Söhne Spaß daran hatten, mich zu quälen. Zum ersten Mal lernte ich Menschen kennen, die mich nicht leiden konnten, die mich hänselten und ärgerten, beschimpften und schlugen. Sie sorgten dafür, dass ich mich eines Mittags, nachdem sie mir wieder einmal aufgelauert hatten, vollkommen verlor. In einem Anfall von dämonischer Ermächtigung schnappte ich mir den Jüngeren der beiden, warf ihn in den Dreck und würgte ihn. Sein Bruder sah bloß fassungslos zu, offensichtlich gelähmt vor Schreck. Ich war wütend, so, so wütend, es würde nie mehr vorbeigehen. Ich bilde es mir nicht ein, ich weiß es, dass ich diesen Jungen umgebracht hätte, wäre seine Mutter nicht gerade noch rechtzeitig aus dem Haus gestürzt, um mich wegzureißen. Das Gesicht des Jungen war schon blau angelaufen. Doch sie bestrafte mich nicht und erwähnte auch den Vorfall meinen Eltern gegenüber mit keinem Wort. Sie wusste, wie ihre Söhne mich die ganze Zeit über behandelt hatten. Von diesem Tag an ließen sie mich in Ruhe.
Ich war kreuzunglücklich in Bad Grund, meinen Eltern erging es kaum besser. Als ich mir auch noch beim Skifahren-Lernen den Arm brach, hatten wir alle genug. Nach nur einem halben Jahr zogen wir wieder um, noch einmal, ein letztes Mal. Elisabeth Siegel, die Professorin, die meinen Vater an der Pädagogischen Hochschule ausgebildet hatte, holte ihn als Assistenten zu sich nach Osnabrück, und ich besuchte ab 1964 meine insgesamt dritte Grundschule. Das zweite Schuljahr lief bereits, was das Ankommen zusätzlich erschwerte. Aber ich kam an, mehr als es meine Eltern je vermocht haben. Wenn es denn überhaupt eine Stadt gibt, die dem Begriff ›Heimat‹ in meinem Leben nahekommt, dann ist es wohl Osnabrück. Dort sind meine beiden Kinder zur Welt gekommen, dorthin bin ich von meinen ersten großen Tourneen zurückgekehrt, dort habe ich insgesamt vierundzwanzig Jahre verbracht.
Wir wohnten in einem dunkelgrauen Vierparteienhaus, die Adresse lautete Ameldungstraße 21, das war am Südrand von Osnabrück, eine lange, schnurgerade, etwas langweilige Vorortstraße im Stadtteil Schölerberg. Alle fünfzehn Minuten fuhr der Bus an den Kleinbürgerwohnhäusern mit den schmalen Vorgärten vorbei, sonst gab es nur ein paar Geschäfte und ein Mädchengymnasium. Vor meinem Fenster stand ein Baum, seine Äste und Blätter ließen wenig Licht ins Zimmer, aber das war mir egal. Die Einrichtung unserer Wohnung störte mich dafür umso mehr. Ich hielt sie für unbeschreiblich geschmacklos. Meine Eltern hielten eisern an ihren ersten Nachkriegsmöbeln fest und weigerten sich hartnäckig, über Neuanschaffungen überhaupt auch nur nachzudenken. Das führte zu verheerenden Ergebnissen. Was vielleicht 1951 in der DDR einmal kurz in Mode gewesen sein mochte, wirkte 1969 in Westdeutschland grotesk fehl am Platz. Die Wohnung war mir peinlich, zumal ich mitbekam, wie es bei anderen Leuten aussah. Reinhard Frense, mein bester Freund, kam aus einer sehr wohlhabenden Familie, sein Vater arbeitete als Architekt. Sie besaßen ein Haus im vornehmen Stadtteil Westerberg, und allein schon ihr Wohnzimmer übertraf die Ausmaße unserer gesamten Wohnung, beinahe meinte man, die Erdkrümmung zu sehen. Alles war so geschmackvoll und stilsicher eingerichtet, dass man bei Frenses ohne weiteres eine Tatort -Folge mit Klaus Schwarzkopf als Kriminalhauptkommissar Finke hätte drehen können. Mord in guten Verhältnissen. Bei uns daheim sah es dagegen aus, als käme in der nächsten Sekunde Heinz Ehrhardt ins Zimmer gehüpft, der junge, wohlgemerkt.
Reinhard sorgte auch noch für ein weiteres Aha-Erlebnis. In der großen Pause packte er regelmäßig ein Sandwich aus, das nicht nur wie meines mit Wurst oder Käse, sondern auch mit einem Salatblatt belegt war. Mit einem Salatblatt! Nicht dass ich besonders scharf auf Salatblätter gewesen wäre. Aber dieser Anblick lehrte mich doch die feinen Unterschiede zwischen den Müttern aus Osnabrück-Schölerberg und denen aus Osnabrück-Westerberg. Stichwort ›Kulturelles Kapital‹. Pierre Bourdieu hätte es mir nicht besser erklären können. Nur weitaus umständlicher.
In Osnabrück begann meine Mutter wieder zu arbeiten. Nach einer kurzen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule wurde sie Grundschullehrerin. Auch mein Vater unterrichtete nach Ende seiner Assistententätigkeit wieder. Er hatte Glück. Nur wenige Jahre später, in den Siebzigern, wäre es einem Mann mit seiner Vergangenheit wohl nicht mehr möglich gewesen, Realschullehrer zu werden. Er liebte seinen Beruf, und er machte ihn gut. Oft haben mich später ehemalige Schüler von ihm angesprochen, erwachsene Frauen und Männer, die sich gerne an seinen Unterricht oder an die gemeinsamen Klassenfahrten erinnerten.
Einmal stand er sogar kurz davor, Rektor seiner Schule zu werden. Er hätte den Posten auch ohne Probleme bekommen, wäre er denn, daraus wurde kein Geheimnis gemacht, CDU-Mitglied gewesen. Nicht nur die Abneigung meiner Mutter gegen jede politische Festlegung stand dem entgegen. Wenn überhaupt einer Partei, hätte sich mein Vater ohnehin nicht der CDU, sondern viel eher dem konservativen Flügel der SPD und damit Leuten wie Leber, Apel oder Schmidt angeschlossen. Daran hatte Elisabeth Siegel, die sozialdemokratische Professorin, die ihn ausgebildet hatte, sicher ihren Anteil. Sie war es auch, die meinem Vater in intensiven Gesprächen immer wieder das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen vor Augen führte. Von manchem erhielt er überhaupt erst durch sie Kenntnis. Kein Wunder. Mitte der sechziger Jahre existierte das Thema in der Öffentlichkeit praktisch nicht. Das Unrecht sollte abgehakt, nicht aufgearbeitet werden.
Umso bemerkenswerter die Offenheit, mit der mein Vater über seine Rolle in der SS sprach, bald auch mit mir. Vielleicht mussten seine Erzählungen zwangsläufig in mir erst einmal den Reflex auslösen, ihn verstehen und sein Verhalten sogar rechtfertigen zu wollen. Ich war ein Kind, ich liebte meinen Vater und wollte einen Sinn in dem sehen, was er getan hatte. Er wehrte müde ab: Lass gut sein, Junge, da war kein Sinn. Es war falsch, und das ist die ganze Geschichte.
Die Vergangenheit holte ihn ein, wenn er gar nicht damit rechnete. Das konnte eher harmlos sein, wie an jenem Morgen, als wir beim Bäcker an der Theke standen und ein alter Herr neben uns plötzlich zu salutieren begann, weil er meinen Vater erkannt hatte: Ich habe Ihnen mein Leben zu verdanken, Herr Unterscharführer! Sie haben uns heil herausgeführt aus dem Kessel von …
Aber es gab auch die unheimlichen Begegnungen. Männer, die wie Albtraumgestalten bei uns zu Hause auftauchten. Etwa zwei alte Waffen-SS-Männer, ehemalige Mitgefangene, einer von ihnen war inzwischen CDU-Abgeordneter. Sie traten rabiat auf und setzten meinen Vater unter Druck, weil er nicht zu den Kameradschaftsabenden auf Schloss Elmau oder sonst wo in Bayern kam, Gruselveranstaltungen, an denen sich damals kein Mensch zu stören schien. Warum bist du nicht dabei, fragten die Männer, »unsere Ehre heißt Treue«, das stand auch auf deinem Koppelschloss, hast du das vergessen? Und mein Vater ist dann tatsächlich hingegangen, sogar mehrmals, ich hoffe heute noch, aus Angst und nicht aus heimlicher Sympathie. Er machte an diesen Abenden den Clown, erzählte Witze und Anekdoten aus der Gefangenschaft, denn das konnte er ja, den Alleinunterhalter geben. Wenn er zurückkam, schämte er sich und war doch auch gleichzeitig ein bisschen stolz, die alten Kameraden zum Lachen gebracht zu haben.
Читать дальше