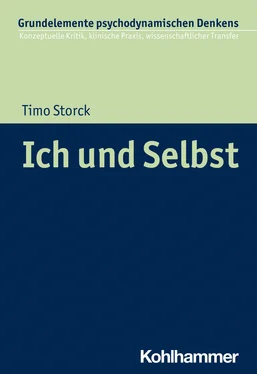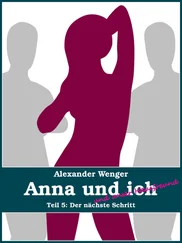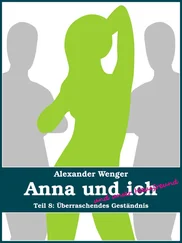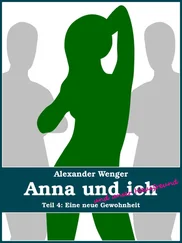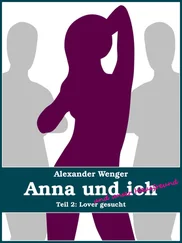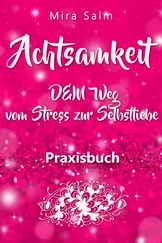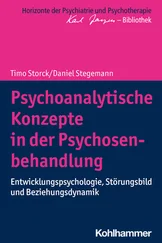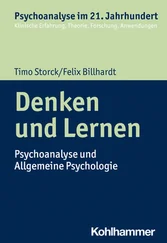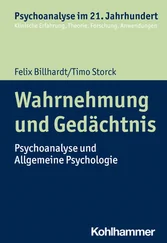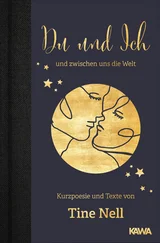Er berichtet, dass er sich von Herrn W. zunehmend bedroht und verraten fühle. Seine Ängste, jemand sei hinter ihm her, hätten sich intensiviert. Er sei unzufrieden mit seiner Lebenssituation, er wolle etwas verändern, aber schaffe es nicht. Herr P. wirkt intelligent und mit einer raschen Auffassungsgabe, er kleidet sich nachlässig und ist in seiner Sprache betont »jugendlich« und abgegrenzt, als würde er alles »Erwachsene« als spießig und kontrollierend ablehnen. Im formalen Denken ist Herr P. oft fahrig, gelegentlich abbrechend, Konzentrationsvermögen und Aufmerksamkeitsfunktion sind beeinträchtig, im inhaltlichen Denken kreist er um seine Ängste, jemand sei hinter ihm her. Es ist vorerst unklar, ob es sich um eine paranoide Dynamik handelt, jedoch scheint die Realitätsprüfung weitgehend intakt zu sein. Selbstwertthemen, auch im Rahmen einer prolongierten Adoleszenz oder emerging adulthood, stehen im Vordergrund, leitende Abwehrmechanismen sind neben dem destruktiven Agieren Wendung gegen das Selbst oder Isolierung.
Das Übertragungsgeschehen zum Analytiker ist schnell von einer ambivalent wirkenden Sehnsucht Herrn P.s nach einem väterlichen Vorbild geprägt, das zugleich massiv bekämpft wird; er sehnt sich, kann sich aber nur schwer auf eine positiv erlebte Abhängigkeit einlassen. In der Gegenübertragung entstehen für Herrn P.s Analytiker Impulse, ihn für sein unangemessenes Verhalten zurechtzuweisen, aber auch Gefühle von Zuneigung, Verbundenheit und Sorge.
Die Biografie lässt sich nur schrittweise rekonstruieren. Der 23-jährige Herr P. stammt aus einer Familie der oberen Mittelschicht einer mittelgroßen Stadt, er hat einen zehn Jahre jüngeren Bruder, den er als »Liebling der Eltern« beschreibt. Seine Eltern beschreibt er als rigide, konservativ und wenig einfühlsam. In seiner Entwicklung habe er immer viel Vergnügen beim Zeichnen gehabt und offenbar über großes Talent verfügt, nach dem Schulabbruch habe er das nicht weiter verfolgt. Seit seiner Jugend habe er Drogen konsumiert (Cannabis, Methamphetamin u. a.) und sei wegen seiner schlechten Schulleistungen und seiner oppositionellen Haltung von den Eltern rausgeworden worden. Er sei dann ins große Haus seiner Tante eingezogen, die bald darauf verstorben sei, so dass er nun auf sich allein gestellt lebe.
Die im Folgenden beschriebene Stunde findet einige Wochen nach Beginn der analytischen Behandlung im Couch-Setting statt (es wäre zu diskutieren, was für oder gegen diese Indikation spricht). Herr P. berichtet davon, dass er am Wochenende bei seinen Eltern zu Besuch gewesen sei, das erste Mal, seitdem er rausgeflogen gewesen sei (»Cancer man«, 2008). Sie hätten ihn dort übernachten lassen, obwohl die Absprache eigentlich sei, dass er erst wiederkommen dürfe, wenn er keine Drogen mehr konsumiere und sich eine Arbeitsstelle gesucht habe. Seine Mutter sei misstrauisch gewesen, aber habe sich wohl gefreut. Sein Vater sei nach wie vor starr und unversöhnlich: »Er nimmt es mir übel, dass ich nicht so bin, wie er mich haben will«. Herr P. habe sich gefreut, seinen kleinen Bruder J. wieder zu sehen. Er habe sich mit ihm in dessen Zimmer unterhalten – über dessen schulische Erfolge oder darüber, dass eine örtliche Zeitung ihm einen Preis für ökologisches Bewusstsein verliehen habe: »Und dann habe ich mich da so umgesehen und gemerkt: Alles ist voller Urkunden und Medaillen. Der Typ ist so krass: Der rechnet wie ein Weltmeister, bekommt beim Fußball eine Trophäe nach dem anderen, ist sozial kompetent und alles. Und dann habe ich mich gefragt, ob es dem eigentlich gut geht. Ich war auch neidisch, klar, aber ich habe mir auch ein bisschen Sorgen um ihn gemacht. Nicht alles, was man im Leben so lernt, findet man in Büchern. Ich dachte, ich will mehr Zeit mit ihm verbringen. Vielleicht gibt es ja auch etwas, das ich ihm mit auf den Weg geben kann.« Dann berichtet er, wie auf einmal die gemeinsame Mutter im Zimmer aufgetaucht sei: »Das war voll so der Kontrollgang. Sie hat so ganz komisch gefragt, ob alles okay ist. Ich habe gesagt: ›Klar, alles gut‹, aber sie war erst zufrieden, als J. das auch gesagt hat. Dann war sie so ganz komisch, ist wieder gegangen, aber hat die Tür offenstehen lassen. Als ob ich so’n Krimineller wäre! Ich habe das J. gesagt – so, denkt die denn, ich verderbe ihr den Lieblingssohn… Und J. hat dann was Komisches gesagt, er meinte so ›Was, ich bin der Lieblingssohn? Ja, klar! Du bist doch praktisch alles, über das sie überhaupt reden.‹« Das habe Herrn P. nachdenklich gemacht. Später am Tag habe er in alten Kisten gekramt und sich daran erinnert, wie er gewesen sei, als er so alt gewesen sei wie J. jetzt. Am nächsten Morgen habe es »den Mega-Stress« gegeben mit den Eltern, weil die einen Joint in der Küche gefunden hätten: »Ey, aber ich schwöre, der ist nicht von mir gewesen. Aber natürlich haben sie mir nicht geglaubt und ich bin direkt wieder rausgeflogen. Als ich an der Straße stand, kam J. nochmal raus – und natürlich war es seiner. Vom perfekten Sohn. Das war mir vorher schon klar. Er hat mich gefragt, warum ich nichts gesagt habe, warum ich es auf mich genommen habe. Ich konnte ihm das gar nicht so richtig sagen.« Sein Therapeut fragt nach: »Was war das, wie kommt es, dass Sie das bei sich gelassen haben?« Herr P. sagt; »Ich wollte nicht, dass er denselben Stress kriegt wie ich. Reicht doch, wenn es einen missratenen Sohn gibt, bei mir macht es für unsere Eltern doch eh keinen Unterschied mehr.« Aus Trotz habe er sich dann auf eine Stellenanzeige beworben und sei auch direkt zum Eignungsgespräch eingeladen worden. Als er dort angekommen sei, habe er gemerkt, dass er nur Werbezettel verteilen sollte, in einem albernen Kostüm. Dann sei er wieder gegangen. Am Abend habe Herr W., der ältere Mann, mit dem er in dubiose Geschäfte verwickelt ist, ihn angerufen und ihm gesagt, er brauche ihn für die Arbeit. Er habe zugesagt.
Nach einer kurzen Pause entwickelt sich folgender Dialog zwischen Analytiker (A) und Herrn P (P):
A: Vielleicht gibt es ja auch einen Teil in Ihnen, der sich in der Rolle des missratenen Sohnes ein Stück weit eingerichtet hat.
P: J. hat noch so viele Möglichkeiten. Alle, die ich auch hatte. Er engagiert sich, ist kreativ, alle lieben ihn. Ich hatte meine Chance, meine Eltern geben mir keine zweite. Warum sollte ich ihm dann auch seine zerstören? Ich habe ihn so gerne. Und ein bisschen sehe ich mich auch selbst in ihm. Aber das ist nichts mehr für mich. Was der sich anzieht, dann Mathe-Wettbewerb, Flöte spielen, ein Astrophysik-Studium, was weiß ich noch. Ich gehöre nicht dazu, ich lebe in einer ganz anderen Welt. (Schweigen)
A: Die zwielichtigen Geschäfte verbinden Sie mit Herrn W. Und das, nachdem Sie zuhause nicht bleiben durften. Nach so einer Verbindung suchen Sie bei Ihrem Vater auch. Etwas Gemeinsames zu tun und sich verbunden zu fühlen.
P: Und was soll das sein? Wirklich, ich habe aufgegeben. Er weiß nichts von mir und ich habe meine Zweifel, ob es ihn interessiert. Er ist nur mit sich beschäftigt und mit seinen Regeln und was die Nachbarn denken. Mehr sagt er nicht. Inzwischen reden wir ja gar nicht mehr. Davor hat er mir aber auch nie wirklich zugehört.
A: Hier mit mir suchen Sie eine solche Verbindung auch, aber dann fragen Sie sich, ob ich Ihnen zuhöre oder ob es mir nur um meine Regeln geht.
P: Ach, kommen Sie. Dass Sie das jetzt sagen, zeigt doch gerade ganz genau, dass es für Sie nur um Sie geht. Sie fangen doch immer davon an, über sich zu reden, nicht ich.
P: (nach einer erneuten Pause, atmet tief aus) Vielleicht ist es auch einfach wichtiger, dass ich meinen eigenen Weg mache. Manchmal will ich nur noch raus und weg, am besten nach Alaska oder so. (Pause) Ich will mich nicht formen lassen zu jemandem, der ich nicht sein kann. Ich will auch nicht ewig darauf warten, dass jemand mich wirklich sieht. … Habe ich erzählt, dass ich am nächsten Wochenende mit A. und ihrem Sohn rausfahren will, raus aus der Stadt? Er möchte gerne zelten und in die Sterne gucken. Das machen wir dann.
Читать дальше