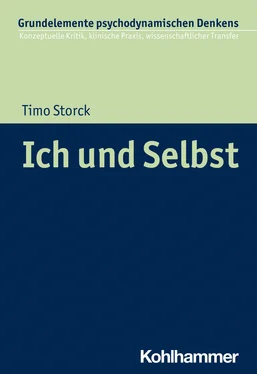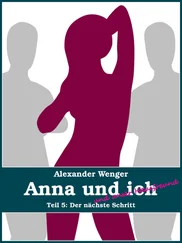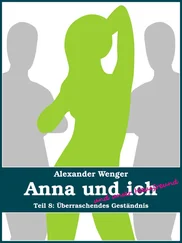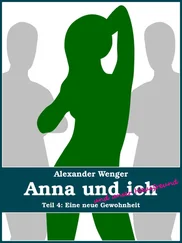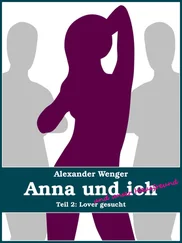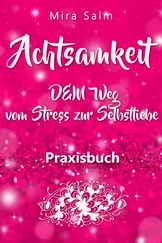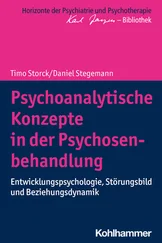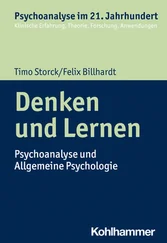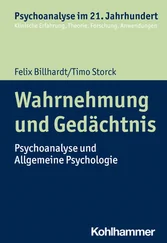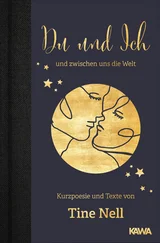Freuds »Selbstanalyse, die ich für unentbehrlich halte zur Aufklärung des ganzen Problems« (a. a. O., S. 288; 3.10.1897), »ist in der Tat das Wesentlichste, was ich jetzt habe, und verspricht von höchstem Wert für mich zu werden, wenn sie bis zu Ende geht.« (a. a. O., S. 291; 15.10.1897) So berichtet er auch von Unterhaltungen mit seiner Mutter und weiteren eigenen Erinnerungen: »Ganz leicht ist es nicht. Ganz ehrlich mit sich sein ist eine gute Übung.« (a. a. O., S. 293)
Auch wenn aus heutiger Perspektive gesagt werden muss, dass eine alleinige Selbstanalyse, also das, wie ehrlich auch immer vollzogene, Nachdenken über eigene Träume, Gedanken und Gefühle recht schnell an ihre Grenzen stößt, wenn es um das Gewahrwerden des (dynamisch) Unbewussten geht, so bleiben Freuds Bemerkungen doch beeindruckend, sie dokumentieren das persönliche Ringen (und den Weg, den er durch die Theoriebildung heraus findet!) (vgl. zum Prozess von Produktivität und Niedergeschlagenheit auch z. B. Alt, 2016, S. 254f.). Am 31.10.1897 schreibt er: »Meine Analyse geht weiter, bleibt mein Hauptinteresse, alles noch dunkel, selbst die Probleme, aber ein behagliches Gefühl dabei, man braucht nur in seine Vorratsräume zu greifen, um seinerzeit herauszuholen, was man braucht.« (Freud, 1985, S. 298) Ebenso zeigen sich die Widerstände in diesem Prozess: »Meine Selbstanalyse stockt wieder einmal, besser, sie träufelt so langsam weiter, ohne daß ich etwas von ihrem Verlauf verstehe.« (a. a. O., S. 299, 5.11.1897) Auch dies erfährt eine Konzeptualisierung: Der Gedanke des Widerstands, hier noch nicht direkt auf den Behandlungsprozess, so doch aber auf die Aufdeckung des Verdrängten bezogen, wird zu einem Kernelement der weiteren Theorie.
Am 14.11.1897 gibt es einen wortreichen Brief mit Gedanken zu Sexualentwicklung, Verdrängung und Neurosenwahl. Freuds Ringen setzt sich fort, aber zunehmend geht es darum, dass er theoretische Überlegungen entwickelt, ohne die er seine Selbstanalyse und Reflexion nicht weiterführen zu können glaubt: »Meine Selbstanalyse bleibt unterbrochen. Ich habe eingesehen, warum. Ich kann mich nur selbst analysieren mit den objektiv gewonnenen Kenntnissen (wie ein Fremder), eigentliche Selbstanalyse ist unmöglich« (a. a. O., S. 305). Außerdem bemerkt Freud, selbstironisch: »Seitdem ich das Unbewußte studiere, bin ich mir selbst so interessant geworden.« (a. a. O., S. 310; 3.12.1897) Damit benennt er deutlich, wie eng seine Auseinandersetzung mit sich selbst und die Theoriebildung miteinander verknüpft sind. Am Ende dieses Prozesses steht der Beginn der Arbeit an der Traumdeutung ab Januar 1898 (veröffentlicht dann in 1899, vordatiert auf 1900). Die regelmäßige Korrespondenz mit Fließ endet in 1902 in der Folge eines Streits über das geistige Eigentum der Konzeptionen zur psychischen Bisexualität, einzelne Briefe folgen noch in 1904.
Für den weiteren Kontext von Freuds Selbstanalyse finden sich Kommentare bei Roudinesco und Plon (1997, S. 919ff.). In ihr sind die Grundzüge analytischer Selbstreflexion und Introspektion angelegt, es treten aber auch die Grenzen einer »Eigenanalyse« zutage; das Erkennen eigener unbewusster Erlebnisaspekte bedarf des Gegenübers beziehungsweise des konkreten Beziehungserlebens. Deserno (2014) benennt als eine Nebenbedeutung von »Selbstanalyse« noch die innere Arbeit von Analysandinnen zwischen den Stunden. Insbesondere ab 1909/1910 (besonders in der analytischen Arbeit C.G: Jungs mit Sabina Spielrein) werden Phänomene der Gegenübertragung deutlicher, so dass in den Folgejahren die erforderliche »kollegiale« Selbstanalyse/Lehranalyse eingeführt wurde. In der Arbeit mit Patientinnen ist es unerlässlich, die eigenen »blinden Flecke« kennengelernt zu haben, um so das eigene Erleben in der analytischen Beziehung zum Ausgangspunkt der Arbeit und der Interventionen machen zu können.
2.3 Freuds Narzissmustheorie: Bildung und Besetzung des Selbst
Die Zeit zwischen 1900 und 1915 (beziehungsweise bis zur Einführung des Instanzen-Modells in den Jahren danach) »läßt sich im Hinblick auf den Ichbegriff als eine [Periode] der Verzögerung charakterisieren« (Laplanche & Pontalis , 1967, S. 191). Hartmann spricht hier von einer »Verzögerung von Freuds Interesse am Ich« (Hartmann, 1956, S. 273) oder einer »Periode verhältnismäßig latenten Interesses am Ich » (Hartmann, 1950, S. 119). Statt der Erörterung des Ichs geht es Freud nun um die Konzeption des Narzissmus und um Überlegungen zu Internalisierungsprozessen, insbesondere zur Identifizierung, womit er auch skizziert, wie sich Vorstellungen des Selbst bilden oder verändern. In seiner Triebtheorie geht es nun um die Unterscheidung zwischen Ichlibido und Objektlibido, also darum, was der Gegenstand libidinöser Besetzung ist (so dass im Grunde eher »Selbstlibido« passender wäre, wenn es darum geht zu beschreiben, dass die Vorstellungen der eigenen Person libidinös besetzt sind). Der Narzissmus wird hier als Teil der Triebtheorie aufgefasst, es ist eine besondere Form der Besetzung. Daher schreibt Hartmann (1956, S. 276): »Das Ich wurde nicht nur als ein Satellit der Triebe angesehen, sondern zeitweise fast völlig von ihnen in den Schatten gestellt.«
Insbesondere in den 1910er Jahren setzt Freud sich, nachdem es ihm davor um die Untersuchung verschiedener Phänomene, in deren Entstehung unbewusste Konflikte eine Rolle spielen, namentlich Symptom, Traum, Witz und Fehlleistung, gegangen war, mit den konzeptuellen Grundlagen der Psychoanalyse auseinander, in den sogenannten metapsychologischen Schriften z. B. zum Trieb, zur Verdrängung oder zum Unbewussten. Einen wichtigen Hintergrund für Freuds Auseinandersetzung mit dem Narzissmus als der Besetzung der Vorstellungen der eigenen Person stellen seine Überlegungen zur Psychose als »narzisstischer Neurose« dar (Freud, 1911c), die er in der Rezeption von Daniel Paul Schrebers (1903) Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken entwickelt (vgl. a. Storck & Stegemann, 2021). Schreber leidet an Verfolgungsideen (er fühlt sich von Gott und seinem Psychiater verfolgt und gequält), Größenwahn (Verbundenheit mit Gott) und einer spezifischen Form der Objektrepräsentanzen (»flüchtig hingemachte Männer«). In Freuds Konzeption werden dabei die Sachvorstellungen verworfen, also aus dem Bereich des bewussten wie unbewussten Psychischen ausgestoßen, so dass stattdessen nur noch die Wortvorstellungen besetzt sind. Das erklärt beispielsweise die Neologismen im Rahmen psychotischer Störungen. Freud konzipiert das Abziehen der Libido von den Objekten (Verwerfung der Sachvorstellung) als einen Rückzug der Libido ins Ich, also eine dann narzisstisch zu nennende Besetzung des Selbst statt der Objekte. Es resultiert eine Selbsterhöhung beziehungsweise »Ichvergrößerung« (Freud, 1911c, S. 309) sowie eine Entleertheit von Objektrepräsentanzen. Nachdem also in einem ersten Schritt die Verwerfung dafür gesorgt hat, dass die inneren Objekte verschwinden, sorgt in einem zweiten Schritt die Projektion für deren Wiederkehr, aber als das Schaffen verfolgender Objekte, die aufgrund von Problemen der Ichgrenzen immer wieder auch mit einem Verlust des grundlegenden Selbstgefühls und Gefühls der Unterschiedenheit zwischen »innen« und »außen« zu tun haben.
Daraus ergeben sich (besetzungstheoretische) Folgerungen für Ich (bzw. Selbst) und Objekt, die Freud in seiner Konzeption des primären und sekundären Narzissmus weiterführt. Dabei geht er von der »Vorstellung einer ursprünglichen Libidobesetzung des Ichs« aus (Freud, 1914c, S. 141), die er als »ursprüngliche[n] Narzißmus des Kindes« (a. a. O., S. 159) oder als »infantile[n] Narzißmus« (a. a. O., S. 160) bezeichnet. Dabei ist aus Sicht Freuds die Libido »im« Ich angesammelt, wenn er von einem »Libidoreservoir« spricht und die Libido in dieser Form als »Ichlibido« oder »narzisstische[.] Libido« (a. a. O., S. 165) bezeichnet. Das ist für ihn die Grundform, nämlich »daß das Ich das eigentliche und ursprüngliche Reservoir der Libido sei« (1920g, S. 55f.). So differenziert er weiter hinsichtlich der Unterschiede zwischen Triebarten: »Die Sonderung der Libido in eine solche, die dem Ich eigen ist, und eine, die den Objekten angehängt wird, ist eine unerläßliche Fortführung einer ersten Annahme, welche Sexualtriebe und Ichtriebe voneinander schied.« (1914c, S. 143)
Читать дальше