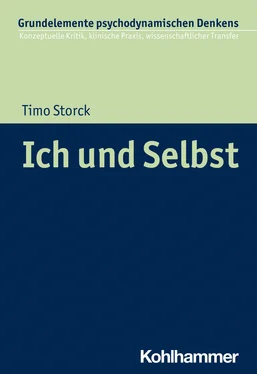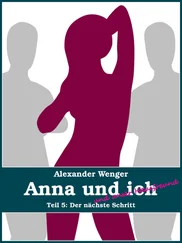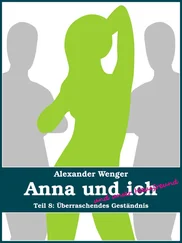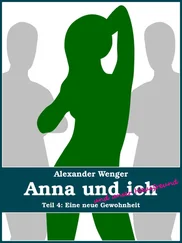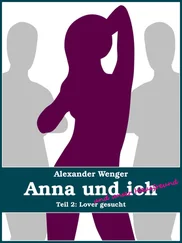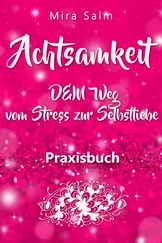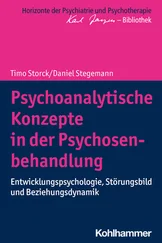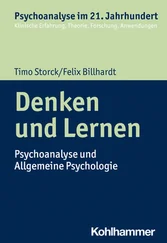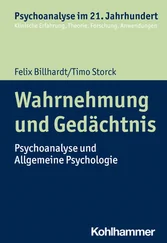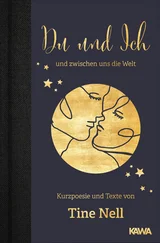Timo Storck - Ich und Selbst
Здесь есть возможность читать онлайн «Timo Storck - Ich und Selbst» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ich und Selbst
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ich und Selbst: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ich und Selbst»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ich und Selbst — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ich und Selbst», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das Konfliktgeschehen besteht psychoanalytisch betrachtet nun nicht allein in motivationalen Konflikten, sondern es lassen sich auch repräsentationale beschreiben, weshalb als nächstes die Konzeption des Objekts erörtert worden ist (Storck, 2019b). Terminologisch stammt die Rede vom »Objekt« aus der Triebtheorie, es geht um das Objekt psychischer Besetzung beziehungsweise das Objekt der Vorstellung, also: die Objektrepräsentanz. Die Grundidee der psychoanalytischen Entwicklungstheorie hinsichtlich dieser besteht darin, dass sich Interaktionen mit anderen psychisch in Form von Beziehungsvorstellungen niederschlagen, die wiederum weitere Interaktionen färben. Aus Beziehungsvorstellungen werden sukzessive Vorstellungen/Repräsentanzen vom Selbst und den Objekten herausgelöst, wobei sich beides auch auf der Ebene der Repräsentation nur als miteinander verbunden begreifen lässt. Psychoanalytisch ist damit die Fähigkeit zur Symbolisierung berührt, also die Möglichkeit, etwas in der Wahrnehmung Abwesendes in der Vorstellung anwesend zu machen. Das ist die Grundlage für Erwartung, Erinnerung, Fantasie, Probehandeln und einiges mehr. Ein wichtiger Entwicklungsschritt besteht dabei darin, zu »ganzen« Vorstellungen von Selbst und Objekten zu gelangen. Gemeint ist, dass sich in der Entwicklung zunächst eine Logik der Spaltung zwischen »gut« und »schlecht« ergibt: Alles Schlechte soll aus dem Selbst herausgehalten werden und die Welt der Beziehungen wird als nur gut oder nur schlecht erlebt. Erst im Zuge haltender Beziehungserfahrungen können positive und negative Affekte derselben Person gegenüber oder unterschiedliche Bilder dieser zusammengebracht, also integriert werden. Die Idee repräsentationaler Konflikte berührt dann auch die Frage, ob Selbst- und Objektrepräsentanzen innere Spannungen aushalten können oder ob es zu Fragmentierungen kommt, indem Spaltungsprozesse aus der frühen Entwicklungszeit aufrechterhalten werden müssen und, mit Kernberg gesprochen, Teil-Selbst- und Teil-Objekt-Bilder vorherrschen ( 
Kap. 5.1.4
).
Die Überlegungen zu Internalisierung und zum Wirken von Selbst- und Objektrepräsentanzen haben eine hohe Relevanz für das klinische Arbeiten der Psychoanalyse, denn sie münden in das Konzept der Übertragung (Storck, 2020a). In Freuds Bemerkungen dazu lassen sich eine weite und eine enge Begriffsfassung unterscheiden. In der weiten Fassung ist mit »Übertragung« basal gemeint, dass die »Intensität« einer Vorstellung auf eine andere, weniger gefährliche übertragen wird. Übertragung ist allgemein ein Mittel des entstellten Bewusstwerdens. Die engere Begriffsfassung bezieht sich konkret auf die analytische Beziehung in der Behandlung, dahingehend dass etwas, das aus früheren Beziehungen (einschließlich der Fantasien darüber) stammt, sich in der Beziehung zum Analytiker zeigt. Auch hier ist es ein Mittel des entstellten Bewusstwerdens, wenngleich Freud (1905e, S. 281) den Doppelcharakter der Übertragung als »größtes Hindernis« und »mächtigstes Hilfsmittel« erst erkennen musste. So wird über das Übertragungskonzept (einschließlich der Gegenübertragung auf Seiten des Analytikers) ein wichtiger Bestandteil der Erkenntnistheorie der Psychoanalyse, denn es wird begründbar, wie unbewusste Aspekte des Erlebens in Behandlungen zugänglich werden. Über die nötige Intensivierung von Übertragungsprozessen begründet sich das analytische Behandlungssetting unter Einsatz der Couch, mit hoher Frequenz von Wochenstunden und einer abwartend-zuhörenden Haltung des Analytikers. Das soll der Regressionsförderung dienen, die wiederum Übertragungsaspekte deutlicher zutage treten lassen beziehungsweise die Übertragung in Richtung einer Übertragungsneurose hin vertiefen soll, das heißt, die Zentrierung der (neurotischen, aber auch sonstigen) Symptome auf die analytische Beziehung, wo sie verstanden und verändert werden können. Über die Reflexion des Geschehens in Übertragung und Gegenübertragung, in Form des szenischen Verstehens, lassen sich nicht-triviale Verstehenshypothesen entwickeln, die verbalisiert als Deutung einen Prozess (der Veränderung) möglich machen.
Diesen Veränderungsprozessen stehen psychodynamisch betrachtet Widerstände entgegen, das heißt, dass sich in Behandlungen diejenigen Abwehrmechanismen zeigen, die zur Unlustvermeidung mobilisiert wurden und nun auch bezüglich des analytischen Prozesses vor Angst schützen sollen. Die Betrachtung von Abwehr und Widerstand (Storck, 2021) hat als Grundidee der psychischen Abwehr unterstrichen, dass diese eingesetzt wird, wenn eine Vorstellung mehr Unlust als Lust nach sich ziehen würde. Die Abwehr (die unbewusst wirkt und sich gegen einen »inneren« Reiz richtet) dient allgemein der Vermeidung unlustvoller Affekte. Dabei lassen sich verschiedene Abwehrmechanismen differenzieren, am wichtigsten ist das Zusammenwirken von Verdrängung und einem weiteren Mechanismus der Ersatzbildung, so dass sich abwehrbedingte Kompromissbildungen im Psychischen ergeben. Etwas muss umgearbeitet werden, damit es bewusst werden darf. Weniger reife Abwehrformen, so etwa die projektive Identifizierung, weisen bereits darauf hin, dass bei schweren psychischen Störungen weniger eng umgrenzte Abwehrmechanismen differenziert werden können, sondern Abwehrformationen (z. B. die von Steiner, 1993, eingeführte »pathologische Organisation«) vorliegen, die eng mit Struktur und Persönlichkeit verwoben sind ( 
Kap. 5
). Darüber hinaus sind psychosoziale Abwehrformen, die nicht nur innerpsychisch, sondern auch »interaktionell« Unlust zu vermeiden versuchen, diskutiert worden. Widerstandsphänomene werden auf das Wirken der Abwehr in der Behandlung zurückgeführt und können sich in vielerlei Weise zeigen; zeitgenössisch entscheidend ist, dass der Analytiker etwas dazu beiträgt. Ein Widerstand muss als kokreativ und als Beziehungsphänomen begriffen werden (einschließlich der Beachtung möglicher Gegenübertragungswiderstände). Eine Brücke zwischen verschiedenen therapeutischen Richtungen findet sich in der Konzeption der Reparatur von Beziehungskrisen, wie Safran und Muran (2000) sie vorlegen.
Bei der Diskussion der Konzepte sind einige Fragen genauer zutage getreten, etwa danach, wann und wie interveniert, genauer gefragt: gedeutet werden soll, insbesondere wenn sich die Deutung doch auf unbewusste Aspekte des Erlebens richten soll. Damit ist auch die Frage danach verbunden, was psychische Veränderung möglich macht (Storck, in Vorb). Im vorliegenden Band soll es ferner um eine Untersuchung der Konzepte »Ich« und »Selbst« gehen, die insbesondere bei Freud nicht immer scharf getrennt werden. Damit verbunden sind Erörterungen dazu, was unter Ich-Funktionen verstanden werden soll (auch im Sinne struktureller Fähigkeiten) und wie sich die Selbstrepräsentanz davon unterscheidet beziehungsweise dazu im Verhältnis steht. Ferner werden die psychoanalytischen Richtungen der Ich-Psychologie und der Selbstpsychologie betrachtet sowie die Fortsetzung der Konzeption der Ich-Funktionen in Strukturkonzepte in der Psychoanalyse beleuchtet. Schließlich erfolgt eine Betrachtung von Ich und Selbst in anderen Wissenschaften sowie anderen psychotherapeutischen Verfahren.
1Ich verwende im vorliegenden Band im kapitelweisen Wechsel außerhalb von Zitaten durchgängig das generische Maskulinum und das generische Femininum. Damit sind jeweils alle anderen Geschlechter mitgemeint.
2 Die Grundlagen von Ich und Selbst bei Freud
Zunächst soll es um einen Blick auf »Ich« und »Selbst« bei Freud gehen. Zu den bekanntesten Zitaten oder Denkfiguren Freuds gehört die Bemerkung, dass das »Ich nicht Herr im eigenen Haus« sei (Freud, 1917a, S. 11). In seinem Selbstverständnis stellt er sich damit in eine Reihe mit Kopernikus und Darwin, insofern er mit der Psychoanalyse dem Menschen eine dritte Kränkung zugefügt habe: Die Erde ist nicht das Zentrum des Universums, der Mensch stammt vom Affen ab und noch dazu wird er von ihm selbst nicht immer ersichtlichen Motiven angetrieben. Das ist eng verbunden mit der Annahme eines dynamisch Unbewussten. Es gibt verdrängte, nicht zugängliche Teile, die sich auch nicht über Anstrengung oder Aufmerksamkeit ins Bewusstsein heben lassen, sondern unzugänglich sind – und den Menschen umso stärker antreiben. Während in frühen Arbeiten Freuds das Ich in unterschiedlicher Weise, u. a. allgemein eher synonym mit »Persönlichkeit«, gebraucht wird (auch in der realitätsgerechten Hemmung primärprozesshafter Abläufe), formuliert er die Überlegungen später (v. a. Freud, 1923b) als psychische Instanz des Ichs aus, das sich über seine Funktionen bestimmt, in erster Linie die Möglichkeiten einer Vermittlung der »inneren« Ansprüche (Trieb, Gewissen) und der »äußeren«, also den Regeln des sozialen Zusammenlebens beziehungsweise der konkreten Folgen von Handlungen. Das Selbst hingegen wird von Freud sehr viel seltener und ungenauer gebraucht. Der Ausdruck taucht einerseits, aber nicht konzeptuell, prominent in Freuds »Selbstanalyse« auf (  Kap. 2.2), ansonsten als Besetzung der psychischen Repräsentanz der eigenen Person mit »Ichlibido« (Freud, 1914c, S. 141). Hier zeigen sich schon die wichtigsten terminologischen Schwierigkeiten: Das Selbst ist das, was mit Ichlibido besetzt wird, die allerdings nur so genannt werden kann, weil es um eine Besetzung der eigenen Person statt der Objekte geht (
Kap. 2.2), ansonsten als Besetzung der psychischen Repräsentanz der eigenen Person mit »Ichlibido« (Freud, 1914c, S. 141). Hier zeigen sich schon die wichtigsten terminologischen Schwierigkeiten: Das Selbst ist das, was mit Ichlibido besetzt wird, die allerdings nur so genannt werden kann, weil es um eine Besetzung der eigenen Person statt der Objekte geht (  Kap. 2.3zur Narzissmuskonzeption bei Freud).
Kap. 2.3zur Narzissmuskonzeption bei Freud).
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ich und Selbst»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ich und Selbst» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ich und Selbst» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.