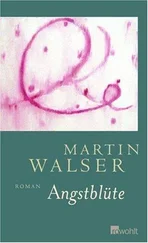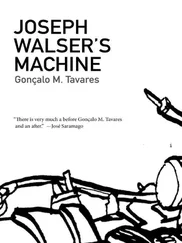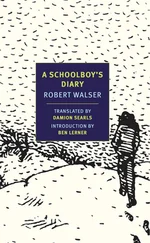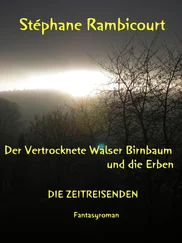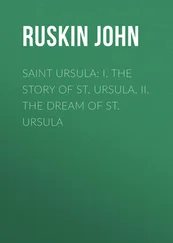Eine weitere Sage zur Ahnfrau als Herrin der Tiere:
Die Gämsmutter beim Langgletscher, Seite 41
Die Bergmutter und ihr Hornkind
Zermatt
Wohl schon vor Tausenden von Jahren, als die ersten Wildbeuter und Hirtinnen vom Süden her in die alpine Gegend des heutigen Zermatt kamen, wird das markante, freistehende Matterhorn auf sie einen ganz besonderen Eindruck gemacht haben. In ihrer magisch-mythischen Sehweise nahmen sie wahr, was wir heute kaum noch auf diese Weise verstehen können: die heilige Landschaft und mittendrin die Bergmutter – sichtbar geworden in ihrer wundersamen Fels- und Eisgestalt voller Schönheit und Magie.
Ihr Anblick ist atemberaubend. Fest steht sie da, die Berggöttin, verankert im Talkessel, und ihr Wirkungsbereich erstreckt sich weit in den Himmel hinein. Am Morgen empfängt ihr Haupt die Strahlen der Sonne und glüht rot auf. Und es scheint, als ob sie ihre Bergzacken wie Arme verlangend ausstreckt, um das Licht zu begrüssen, es in orangen, goldenen, gelben und weissen Tönen an ihrem hohen Leib hinunter und ins ganze Tal fliessen zu lassen. Abends, wenn die Sonne untergeht, lässt sie sich noch einmal von ihr küssen, um dann in einem Meer von Farben zu baden, bis die ersten Sterne ihr Haupt umkränzen und sie nun auch die gesammelte Kraft der Gestirne ins Land gleiten lässt. Und wenn der volle Mond im Osten aufkommt, streckt sie ihre Arme ebenso dem silbernen Licht entgegen.
Und mit ihr tut dasselbe das Hörnli, das kleine Horn – ein Bergkind, das neben ihr auf dem waagrechten Felspodest sitzt. Es zeigt in kindlicher, kurzer Form eine ähnliche Gestalt wie seine Mutter, und ebenso wie diese streckt es sich dem aufgehenden Licht zu.
Die frühen Menschen erkannten die Bergmutter noch in einer weiteren Erscheinung. Wenn sommers der Schnee auf ihrer Ostseite dünn ist, kann man in der Mitte ihres Oberkörpers, zwischen den ausgebreiteten Armen, kleine Brüste sehen. Es sind drei an der Zahl, für eine Göttin nicht ungewöhnlich – umso grösser ist ihre Macht und Kraft, im Tal einen Paradiesgarten zu schaffen. Und die Menschen wussten denn auch während eines langen, goldenen Zeitalters die Gaben der Bergmutter zu schätzen und ihre Gesetze zu befolgen. Noch immer sind Kultplätze bekannt, wo man sie verehrt und ihre umsorgende Kraft gewürdigt hat.
Die Mütterlichkeit der Berggöttin umfasste nicht nur die Welt der Lebenden. Auch die Seelen der Verstorbenen waren bei ihr gut aufgehoben. Sie gingen ein in ihren Schoss unter dem Eismantel, der von ihren ausladenden Hüften herabfliesst. Dort wohnten die Seelen, bis die Bergmutter sie mit der Gletschermilch wieder ins irdische Leben entliess. So erfuhren es die Menschen der frühen Zeit, und das Hörnli war Garant für dieses Geschehen. Die künftigen Menschenmütter konnten die Seelen ihrer Kinder am Schwarzsee abholen. Auch heute gehen Frauen mit Kinderwunsch dorthin, zur «Maria zum Schnee», zur Bergmutter, die nun in einer Kapelle verehrt wird.
Immer noch ist der Anblick des Matterhorns atemberaubend, obwohl der Berg heute kaum als Göttin wahrgenommen wird. Aus aller Welt pilgern Menschen millionenfach hierher, vielleicht auch, um dieser Landschaftsahnin unwissentlich und unbewusst zu huldigen – so stark ist ihre Anziehungskraft.
Nach Göttner-Abendroth 2016, S. 323
Die Menschen der frühen, vorgeschichtlichen Zeit erfuhren gewisse Erhebungen und Berge als Orte der Urmutter, gar als eine Landschaftsahnin: eine irdische und himmlische Macht und zugleich Gebieterin der Unterwelt. So gilt wie viele andere Berge auch der Mount Everest als Berggöttin. Die Himalaya-Völker nennen sie Chomolungma, was «Mutter des Universums» bedeutet; sie verehren sie als «Weisse Himmelsgöttin», als «Weisse Gletscherherrin». 15In ihrem Buch «Berggöttinnen der Alpen» erschliesst uns Heide Göttner-Abendroth diese Sicht für das Matterhorn. 16Die manifestierte Gestalt der Bergmutter Matterhorn kann man am besten vom Gornergrat aus wahrnehmen. Sie ähnelt den stilisierten Göttinnenfiguren aus der Steinzeit, wie sie zu Tausenden in Alteuropa gefunden wurden: dreieckiger Kopf, verkürzte Arme, breite Hüften, mit oder ohne Beine.
Archäologische Funde belegen, dass sich in dieser Bergregion seit Jahrtausenden Menschen aufgehalten haben: als Wildbeutergruppen, als Hirten, als Reisende. 17Sie kamen von Norditalien her, wo in der Jungsteinzeit sesshafte matriarchale Kulturen blühten. Nach und nach wurde die Route in die Zermatter Bergregion zu einem festen Weg weiterentwickelt. Dieser ging von der Poebene über das Aostatal durchs Valtournenche zum Theodulpass hinauf und führte am Fusse des Matterhorns vorbei über den Col d’Hérens ins Val d’Hérens und dann ins Rhonetal. Hier gab es schon im 6. Jahrtausend v. Chr. bäuerliche Siedlungen. In der Mittelsteinzeit, also etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, entwickelte sich bei der heutigen Stadt Sitten eine der bedeutendsten Grab- und Sakralstätte Alteuropas. 18
Sagen berichten von einem goldenen Zeitalter: Wiesen, Fruchtbäume und Wälder wuchsen bis weit oberhalb der heutigen Waldgrenze, und ganze Herden von Gämsen, Steinböcken, Hirschen bevölkerten die hochalpinen Gebiete. Die Passübergänge waren eisfrei, und die Route vom Aostatal über Zermatt bis ins Rhonetal soll an saftigen Weiden, an Dörfern und Städten vorbeigeführt haben. 19Das goldene Zeitalter, das zeitlich nicht genau verortet werden kann, ging jäh zu Ende, als sich erneut eine Kältephase einstellte, Alpen vereisten, die Gletscher zu wachsen anfingen und Dörfer bedrohten. Belegt ist eine solche Periode relativ kühlen Klimas, die sogenannte Kleine Eiszeit, von Anfang des 15. Jahrhunderts bis in das 19. Jahrhundert hinein. Sie führte zu schlechten Ernten, Hungersnöten, Seuchen und sozialen Spannungen. Es gibt im ganzen Alpenraum eine Fülle von Sagen, die sich auf diese Klimaveränderungen beziehen.
Bei Zermatt, oberhalb des Weilers Zmutt, sind noch heute zwei grosse Steinplatten mit vielen Schalen und Ritzungen zu sehen, die zum Teil aus uralter Zeit stammen und wohl auch auf eine kultische Verwendung schliessen lassen. 20An den vermutlich vorgeschichtlichen Kultstätten von Blatten, Furi, Findeln und Schwarzsee stehen heute Marienkapellen, die durch ihre Atmosphäre und besondere Mariendarstellung immer noch auf die Berggöttin hinweisen. 21
Goms
Noch im letzten Jahrhundert berichteten die alten Leute im Goms oft von der Hohbachspinnerin. Sie soll auf der Hohbachalp südlich von Reckingen gewohnt haben und war ein gar seltsames Wesen, selbst die Alpknechte fürchteten sich vor ihr; niemand wollte mehr mit den Tieren dort hinaufgehen.
Wie man erzählte, soll die Hohbachspinnerin ein furchtbarer Anblick gewesen sein: ein grimmiges, altes Weib, nur noch Haut über Knochen, mit langen Zähnen, und auf ihrer Schulter sass eine schwarze Katze mit feurigen Augen. Ganz unerwartet sei die Frau plötzlich vor einem aus dem Boden gewachsen – vor allem dann, wenn man lieber versteckt hielt, was man gerade vorhatte.
Immer, wenn man die Alte traf, war sie an der Arbeit mit einer Handspindel. In ihrem Zuhause soll sie ein weiteres, ganz besonderes Spinnrad besessen haben. Die Fäden, die sie damit spann, schienen einen erheblichen Einfluss auf das Schicksal der Menschen im Tal zu haben. So jedenfalls erzählten es die Alten. Doch wie sehr man die Spinnerin auch fürchtete, die Hohbacherin tat eigentlich niemandem etwas zuleide. Sie strafte auch die ungehorsamen Kinder nicht, denen man oft mit ihr drohte. Gern erschreckte sie jedoch faule Spinnerinnen oder solche, die über dem Dorfklatsch das Arbeiten vergassen. Oder sie tadelte mitunter Frauen, welche die Spinnzeiten nicht einhielten und noch nachts und während der Festzeiten nicht aufhören konnten, die Wirtel zu drehen oder das Rad zu treten. Manchmal kam es vor, dass ein Mädchen für einige Zeit aus dem Dorf verschwand und es sich später herausstellte, dass es bei der Hohbacherin gewesen war und dort spinnen und andere wichtige Dinge gelernt hatte.
Читать дальше