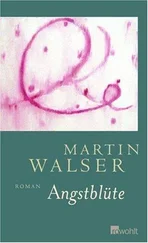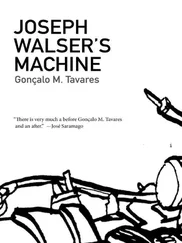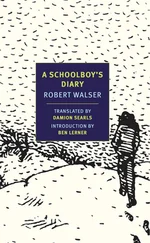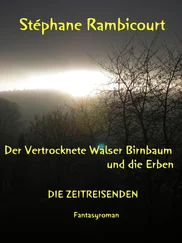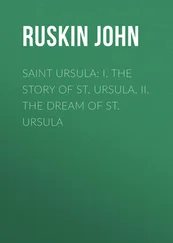Die Sagen erzählen nicht nur von der umfassenden Macht und Kraft und vom Wirken der Grossen Ahnfrau, sondern auch von deren Vertreibung aus dem Denken und Fühlen der Menschen. Doch wir wissen: Sie ist auch Heilerin und Wiedergebärerin, trägt viele Namen und zeigt sich den Menschen zu den unterschiedlichsten Zeiten und in vielfältigen Erscheinungsformen. Wir haben die Chance, sie neu für uns zu entdecken.

Rittplatte oder Ahnenstein, Guggistafel, Lötschental

Matterhorn, Zermatt

Kultstein, Ochsenfeld, Binntal

Guggisee, mit Anen- und Langgletscher, Lötschental

Schneewehe
Die drei Schicksalsfrauen an der Rhonequelle
Gletsch
Vor vielen tausend Jahren, als der Rhonegletscher seine gewaltige Zunge aus der Gegend der heutigen Stadt Lyon bis in den Talkessel der damals noch nicht existierenden Siedlung Gletsch zurückgezogen hatte, wanderten die drei Schicksalsfrauen über die Berge. Sie wollten nach dem Rechten sehen in dem Land, das durch Eis und Wasser in den Untergrund gegraben, gehobelt und geschliffen worden war. Es war das Urmuster eines Tales, das die Römer viel später Wallis nannten. 5
Noch hatte sich hier niemand niedergelassen. So waren die Schicksalsfrauen unterwegs, um diese karge Gegend für Pflanzen, Tiere und Menschen vorzubereiten, die sich hier ansiedeln wollten. Sie wanderten entlang der gewaltigen Gletscherzunge mit ihren Rissen und Schründen. Wasser rauschte, und ein kalter Luftzug kam aus tiefen, bläulich schimmernden Spalten. Mit Leichtigkeit sprangen die drei Frauen über Bäche, die sich aus den vielen Rinnsalen des Gletschers an seinem Ende bildeten.
Jede Frau trug einen Stab in der Hand, der eine war mit einem Bergkristall, der zweite mit einer Muschel, der dritte mit einem Knöchelknochen verziert. Mit ihnen suchten die Schicksalsfrauen im Talgrund nach einem geeigneten Platz für ihr Wirken. Hinter einem gewaltigen Tschuggu , einem abgeschliffenen Felsen, den der Gletscher hier zurückgelassen hatte, schlugen sie die Stäbe in den Boden. Zischend trat heisser Dampf aus den Öffnungen, Erddünste breiteten sich aus und eine Mulde füllte sich mit warmem Wasser.
Alsbald lagen die drei Frauen in dieser wohligen Wärme, und in bester Schöpferinnenlaune begannen sie, das Netz des Lebens in diesem Tal zu erwecken. Die Kristallfrau hob ihren Stab und rief die Kraft und Schönheit der Blumen und Pflanzen, die Seelen der Tiere und Menschen. Die Muschelfrau beschwor ihre Verbindung zum Meer, wo alles Leben einst begonnen hatte und wohin das Quellwasser fliessen sollte. Sie versprach Nahrung, Schutz und Hilfe für alle Wesen. Die Knochenfrau wusste um Wandlungen und Verwandlungen, um Grenzen und Übergänge, um den Tod und die Zuversicht, dass das Leben weitergeht. Leise und sanft sangen die Schicksalsfrauen ihre Melodien. Und mit dem Wasser, das mittlerweile aus drei Quellen floss, ergoss sich ihr Segen in den Gletscherbach und durchs ganze Tal.
Die Menschen folgten dem Ruf der Schicksalsfrauen, sie kamen von weit her und schufen ihre Siedlungen. In ihrer hellhörigen Art konnten sie noch jahrhundertelang wahrnehmen, wie die Wünsche und das Lachen der drei Frauen in der Landschaft nachklangen. Hirtinnen, Jagdvolk, Säumer und Reisende rasteten bei dem warmen Wasser und wussten dessen Heilkraft zu nutzen.
Diese Quellen galten den einheimischen Menschen bis im 18. Jahrhundert als Ursprung der Rhone. Besonders verehrt hat man die Quelle, die einen rötlichen Niederschlag absonderte und deshalb die Rothe hiess. 6Sie gab ihren Namen wohl auch dem Gletscherbach Rhone, der bis in unsere Zeit hinein im oberen Wallis Rotten oder Rottu genannt wird.
Doch längst ist die rote Quelle gefasst; das Hotel Glacier du Rhône nutzt sie zu Heizzwecken. Der Gletscher, der heute vom Talgrund aus nicht mehr sichtbar ist, gilt nun offiziell als Quelle der Rhone. An schönen Sommertagen wälzt sich der Verkehr der Passstrassen von Grimsel und Furka durch die Siedlung Gletsch. Doch noch immer soll es vorkommen, dass Menschen, die sich auf den Moränenhügel bei der kleinen Kapelle und zu den Quelltümpeln zurückziehen, ganz unvermittelt die ursprüngliche Heiligkeit des Ortes erfahren.
Frei erzählt
Die Ahnfrau des Landes zeigt sich oft in dreifacher Gestalt. Auch der Walliser Sagenforscher Josef Guntern hat in seiner Sammlung drei Frauen beschrieben (Guntern 1979, Nr. 1159). Es sind wehmütige Geistwesen, die mit ihren Stöcken im Aletschgebiet gesichtet, in ihrer mythologischen Bedeutung nicht mehr erkannt und so zu Armen Seelen degradiert worden sind. Doch im Kessel des Gletschervorfelds der Rhone können sie sich in ihrer wahren Gestalt zeigen: Sie sind die Begründerinnen der ganzen Talschaft, die drei Schicksalsfrauen, wie man sie überall auf der Welt gekannt und verehrt hat.
Der Dreifrauenkult ist eine Mythologie, die auf allen Kontinenten anzutreffen ist und aus vorgeschichtlicher, mutterorientierter Zeit stammt. In Nordeuropa nannte man die drei Schicksalsfrauen Nornen, in Rom Parzen, in Griechenland Moiren und bei den Kelten Bethen. In den Sagen und Märchen erscheinen sie als drei Weisse Frauen, drei Schwestern oder drei Spinnerinnen, die den Lebensfaden führen, ihn aber auch trennen. Sie spinnen das Glück und weben das Schicksal. Man nannte sie auch Matronen oder Matres. Sie waren die Urmütter, die man anrief, um Heilung, Segen und Schutz zu erlangen. Sie erschienen in dreifacher Gestalt, wohl weil man versuchte, sie in ihrer umfassenden Ganzheit zu verstehen: als Schöpferin, als Lebenserhalterin und als Todesmutter.
Während der Christianisierung bot die Kirche Gegenbilder wie die Drei Marien, die dreigestaltige Anna oder die drei Nothelferinnen Margaretha, Barbara und Katharina. Diese heiligen Frauen sind im Wallis auf vielen Altären zu finden, so zum Beispiel auf dem linken Seitenaltar in der Marienkirche in Münster. Von den Nothelferinnen hiess es im Alpenraum: «Margaretha mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl.» 7
Auch die Rhone trägt noch den Namen einer Erd- und Wassergöttin. Flussnamen sind oft sehr alt, und das Wallis, die Westalpen und das Rhonetal sind frühe Besiedlungsregionen. Bei den Griechen heisst der Fluss, der das Wallis durchfliesst, Rodanos, und bei den Römern Rhodanus. Doch dieser Name ist höchstwahrscheinlich weder griechisch noch römisch, keltisch oder indogermanisch, sondern wohl vorindoeuropäisch oder alteuropäisch. Die Silbe *dan im Namen Ro-dan-os ist eine sehr alte Bezeichnung für Wasser. Gleichzeitig finden wir diese Wortwurzel auch bei der Erdgöttin Ena/Ana/Anu/Dana/Danu. Sie war die altorientalische und alteuropäische Muttergöttin. Da *dan und *an Wasser oder Quelle bedeuten, tragen es viele Flüsse in ihren Namen: so etwa die Donau (Danuvius) , der Inn (Ainos) , der Rhein (Rhenus) oder eben die Rhone (Rhodanos ). 8
Читать дальше