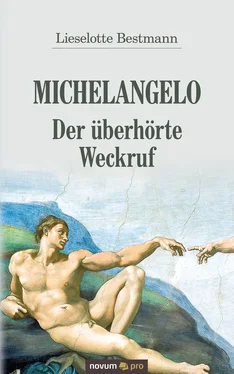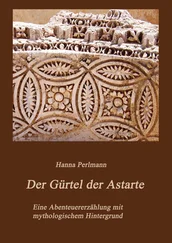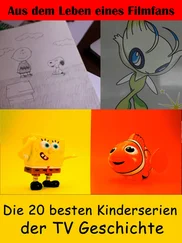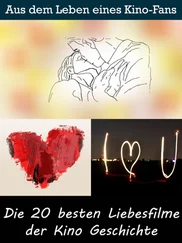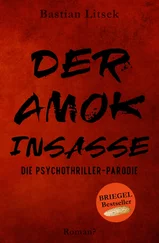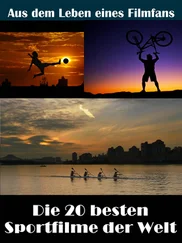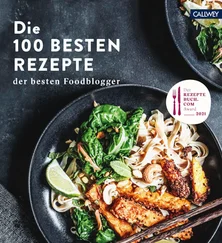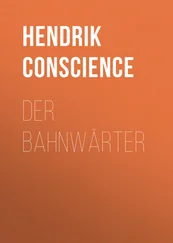Sein Gönner Giovan Francesco Aldovrandi ließ sich abends, wie die Chronisten berichten, von Michelangelo aus Dante, Boccacco und Petrarca vorlesen. Vermutlich durch seine Vermittlung erhielt Michelangelo den Auftrag, in der Kirche San Domenico die am Grabmal des Heiligen Domenico noch fehlenden Statuen des Heiligen Petronius sowie des Heiligen Prokulus und einen noch fehlenden Leuchterengel anzufertigen.
4Condivi, XV., S. 25f.
Auf dem Weg zum Ruhm – Michelangelos Pietà
In Florenz beruhigte sich die politische Lage und Michelangelo kehrte 1495 in seine Heimatstadt zurück. Ebenfalls zurück kehrten Lorenzo und Giovanni di Pierfrancesco, die einer Seitenlinie der Medici entstammten und von Piero de’ Medici verbannt worden waren. Für Lorenzo fertigte Michelangelo einen Johannesknaben an, der wahrscheinlich bereits vor Michelangelos Flucht begonnen wurde und heute als verschollen gilt. In dieser Zeit entstand auch ein heute ebenfalls verschollener Schlafender Cupido, der laut Condivi Lorenzo di Pierfrancesco so begeisterte, dass er vorschlug, ihn auf antik zu trimmen, um auf dem Antikenmarkt in Rom einen besseren Preis zu erzielen. Anfang 1496 wurde dieser Cupido für dreißig Dukaten nach Rom verkauft und für zweihundert Dukaten an Raffaele Riario, Kardinal von San Giorgio, weiter verkauft. Die Fälschung wurde kurz darauf erkannt und bereitete Michelangelo viel Verdruss. Kardinal Riario erhielt zwar anstandslos sein Geld zurück, war jedoch von dieser Bildhauerarbeit so begeistert, dass er Jacopo Galli bat, nach Florenz zu reisen und mit Michelangelo Kontakt aufzunehmen, um sich zu vergewissern, dass dieser Cupido tatsächlich das Werk eines so jungen Künstlers war.5
In dieser leidigen Geldangelegenheit und mit einem Empfehlungsschreiben von Lorenzo de’ Medici reiste Michelangelo Mitte 1496 nach Rom, wurde bei den Florentiner Bankiers und bei Kardinal Riario vorstellig und fand Unterkunft im Hause von Jacopo Galli.6 Hier entstand Michelangelos Bacchus, der nachweislich 1497 von Kardinal Riario bezahlt, von ihm jedoch nie abgeholt, sondern im Garten der Familie Galli aufgestellt wurde.7
Noch im gleichen Jahr begab sich Michelangelo – ausgerüstet mit wichtigen Empfehlungsschreiben – nach Carrara und erwarb einen großen Block aus bestem weißen, feinkörnigen Marmor, bestimmt für ein Auftragswerk des französischen Kardinals Jean de Bilhères-Lagraulas (Abt von Saint-Denis und Botschafter am Hof von Papst Alexander VI. Borgia). Im Jahre 1500 war es vollendet, dieses unumstrittene Meisterwerk Michelangelos: Die Pietà von St. Peter.8
Condivi berichtet hierzu: „Wenig später bildete er auf Verlangen des Kardinals von San Dionigi (…) aus einem Stück Marmor jene wunderbare Statue Unserer Lieben Frau (…) mit dem toten Sohn auf dem Schoße, von so großer und seltener Schönheit, dass niemand sie sieht, ohne sich im Innersten von Mitleid bewegt zu fühlen. Ein Bild, wahrhaft würdig jenes Menschentums, welches sich für den Sohn Gottes und für eine solche Mutter ziemt, wenn es auch einige gibt, die an dieser Mutter tadeln, dass sie zu jung sei im Vergleich zum Sohne. Als ich darüber eines Tages mit Michelangelo sprach, antwortete er mir: „Weißt du nicht, dass die keuschen Frauen sich viel frischer erhalten als die unkeuschen? Um wieviel mehr eine Jungfrau, der niemals die kleinste lüsterne Begierde beigekommen ist, die den Körper entstellen könnte? Ja ich will dir sogar sagen, dass eine solche Frische und Jungendblüte, außer dass sie sich auf natürlichem Wege in ihr erhalten hat, auch dadurch glaublich wird, dass so, durch göttliche Wirkung und Hilfe, der Welt die Jungfräulichkeit und ewige Reinheit der Mutter bezeugt werden soll. Das war bei dem Sohn nicht notwendig, sondern vielmehr das Gegenteil, da ja gezeigt werden sollte, dass der Sohn Gottes in Wahrheit den Leib des Menschen, wie er es getan hat, annehmen und allem unterworfen sein musste, dem ein gewöhnlicher Mensch unterliegt, ausgenommen die Sünde; das Menschliche brauchte nicht durch das Göttliche verdeckt, es brauchte nur in seinem Gang und Gesetz gelassen zu werden, so dass es jenes Alter zeigte, das es gerade hatte. Daher hast du dich nicht zu verwundern, wenn ich aus dieser Rücksicht die Allerheiligste Jungfrau, die Muttergottes, im Vergleich zum Sohn viel jünger gemacht habe, als es jenes Alter gewöhnlich verlangt, dem Sohn aber sein Alter ließ.“ Und Condivi fügte diesen Worten Michelangelos wichtige eigene Worte hinzu: „Eine Betrachtung, jedes Theologen würdig und an anderen vielleicht erstaunlich, nicht aber an ihm, den Gott und die Natur gebildet haben, nicht nur, um mit der Hand Einzigartiges zu schaffen, sondern der auch jedes göttlichen Gedankens fähig ist, wie es sowohl aus dem Gesagten wie auch aus so vielen seiner Bemerkungen und Aufzeichnungen sich erkennen lässt. Michelangelo mochte, als er dieses Werk schuf, 24 oder 25 Jahre alt sein. Er erwarb sich durch diese Arbeit einen großen Ruf und Namen, so sehr, dass es bereits die Meinung der Welt war, dass er nicht nur jeden anderen seiner Zeit und der vor ihm weit überflügelte, sondern sogar mit den Alten wetteifere.9 “
5Condivi, XVIII., S. 27.
6Condivi XVIII., S. 28.
7Christina Acidini Luchinat, Michelangelo, S. 50.
8Herbert Alexander Stützer, Die Italienische Renaissance, Abb. 139, S. 204.
9Ascanio Condivi, Das Leben des Michelangelo Buonarroti, XX., dt. Übersetzung R.Diehl, Insel-Verlag, o. J. S. 30.
Rückkehr nach Florenz – Michelangelos David
Die Pietà begründete zwar den Ruhm Michelangelos, doch er blieb nicht in Rom, sondern folgte dem Ruf von Freunden nach Florenz. Dort lag seit langem ein als „verhauen“ geltender großer Marmorblock im Hof der Dombauhütte, der vergeben werden sollte. Michelangelo überzeugte mit seiner Zusage, aus diesem eine Statue aus einem Stück zu fertigen und erhielt den Block. Als Werkstatt und zugleich Schlafplatz diente ihm ein abgetrennter Raum in der Dombauhütte. Er schuf aus diesem „verhauenen Block“ seinen David.10 Sowohl Donatello11 als auch Verrocchio12 hatten ihren Bronze-David dargestellt als zartgliedrigen Jüngling, nach vollbrachter Tat, das Schwert in der Hand und das abgeschlagene Haupt des Riesen zu Füßen. Michelangelos David dagegen ähnelt mit seinen breiten Schultern und der athletischen Figur eher einem Herkules und dargestellt ist der Moment vor der Tat. Die Schleuder bereit zum Einsatz blickt er mit in Falten gezogener Stirn konzentriert und furchtlos auf den sich nahenden Gegner.
Im Winter 1503/1504 war sein David vollendet und wurde durch Beschluss einer aus den vornehmsten Künstlern von Florenz bestehenden Kommission nicht in der Nähe des Doms, sondern vor dem Palazzo della Signoria (heute Palazzo Vecchio) aufgestellt. Dieser Standortwechsel beinhaltet sowohl einen Bedeutungswechsel der Statue von der biblischen hin zur politischen Inanspruchnahme als auch der Demonstration von ständiger Bereitschaft und unter göttlichem Schutz stehender Kraft.
Nach Vollendung seines David folgte auf Bitten seines Freundes Soderini ein heute verlorener Bronze-David, der dem David Donatellos nachempfunden sein sollte, und als Geschenk nach Frankreich ging. Im gleichen Zeitraum entstand im Auftrag der flandrischen Kaufmannsfamilie Moscheroni der Bronzeguss einer Madonna mit Kind, der nach Fertigstellung nach Flandern geschickt wurde, sowie im Auftrag von Angelo Doni, eines angesehenen florentiner Bürgers, das sogenannte Doni-Tondo, das Michelangelo malte, um – wie Condivi erwähnt – die Malerei nicht ganz aufzugeben.13
Nach Condivi folgte dann eine Zeit, in der Michelangelo „fast nichts in seiner Kunst hervorbrachte, in der er sich damit beschäftigte, die heimatlichen Dichter und Redner zu lesen und Sonette zu seinem Vergnügen zu machen, …“14
Vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung Michelangelos gewinnt diese Bemerkung Condivis besondere Bedeutung, lässt sie doch erkennen, dass Michelangelo bereits zu diesem frühen Zeitpunkt sich intensiv und aus eigenem Antrieb mit dem Verfassen von Gedichten beschäftigte. Michelangelo schuf in seinem langen Leben eine Vielzahl von Gedichten, in die seine Gedanken einflossen und die uns heute behilflich sein können, uns dem Verständnis seiner Bildwerke zu nähern. Zu Lebzeiten Michelangelos und auch in den folgenden Jahrhunderten fanden seine Verse nur wenig Anklang. Sie entsprachen nicht dem Zeitgeschmack. Und doch hatte – wie bereits eingangs erwähnt – schon der bedeutende zeitgenössische Dichter Francesco Berni von Michelangelos Dichtungen gesagt: „Ihr sagt nur Worte, aber er sagt Dinge.“15
Читать дальше