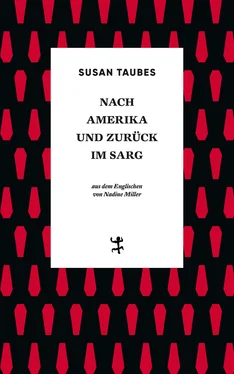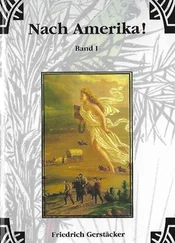Ich starb an einem Dienstagnachmittag, von einem Auto überfahren, als ich gerade die Avenue George V überquerte. Es regnete stark. Ich kam gerade vom Friseur. Dem Verkehr nach zu urteilen, der an Heftigkeit zunahm, aber noch keinen Stau hatte, muss es kurz vor achtzehn Uhr gewesen sein. Ich entdeckte ein freies Taxi, winkte ihm zu. Ich trat vom Bordstein und versuchte nach Möglichkeit, die Straße zu überqueren. Da sah ich den Portier des Hotels gegenüber mit einem übergroßen Regenschirm auf das Taxi zusteuern und schrill in seine Pfeife blasen. Ich stürzte drauflos. Ich wurde auf die Mitte der Fahrbahn geworfen und sofort überfahren. Der Rest der Geschichte ist verschwommen. Weil es regnete, sammelten sich nur wenige Zuschauer. Die Polizei und der Krankenwagen waren in Minutenschnelle da. Und der Verkehrsstrom hatte sich binnen einer halben Stunde normalisiert.
Es geschah so plötzlich, außerdem dachte ich gerade an etwas anderes. Aber mit ziemlicher Sicherheit bin ich tot. Es steht in der Zeitung. Der Arztbericht liegt bei der Polizei auf dem Schreibtisch, obwohl ein offizieller Totenschein erst morgen früh ausgestellt werden kann; »femme décapitée dans le XVIII earrondissement« hieß es im France Soir , und das Gefühl, wie mein Kopf vom Rumpf gerissen wird, lebt noch nach. Mein Körper wächst ins Unermessliche, Billionen von Zellen sind plötzlich freigesetzt, dehnen, beschleunigen, drängen sich jubelnd, eilen zu den sieben Toren von Paris hinaus: Porte de Clichy, Porte de la Chapelle, Porte d’Orléans, Porte de Versailles; die Finger meiner ausgestreckten Arme tauchen ein in die Wälder von Boulogne und Vincennes.
Liebster,
ich komme. Lass Dich von dem Crillon-Briefpapier nicht verwirren. Ich bin schon unterwegs, heute Nacht fliege ich von Paris ab. Fünf Tage Amsterdam (ich schrieb Dir von der Konferenz); vielleicht kann ich es auf drei Tage beschränken, dann bin ich am Sonntag, dem Elften, morgens in New York mit Icelandic Airlines. Ich telegrafiere, sobald ich es genau weiß. Leg für alle Fälle einen Schlüssel unter den losen Stein. Hoffentlich bekommst Du dies noch rechtzeitig. In den letzten Wochen konnte ich unmöglich schreiben. Arbeitstermine, die Kinder mussten für den Sommer bei meiner Schwägerin untergebracht werden, und dann der endgültige Auszug – eine deprimierende Ansammlung von Zeug. Aber jetzt ist es geschafft. Endlich bin ich frei, die Schlüssel den Nachmietern übergeben, mein einziger Koffer in der Gepäckaufbewahrung am Flughafen. Ich bin den ganzen Tag spazieren gegangen, nur mit meinen Papieren und Deinem Bild in meiner Tasche, ganz wunderbar leicht.
Bin über verschiedene Straßenmärkte gelaufen, begaffte die ewiggleichen Käsesorten und das appetitlich zur Schau gestellte Obst, sogar die grünen Bohnen liegen ordentlich in Reih und Glied; verirrte mich auf dem Blumenmarkt. Saß fast eine Stunde lang in der Empfangshalle des Crillon und versuchte, Dir zu schreiben. Dann spazierte ich an der Place Vendôme herum und besah mir die Auslagen in den Schaufenstern. Erst als die Geschäfte alle zu Mittag schlossen, fiel mir ein, dass ich mir vielleicht für den Nachmittag etwas vornehmen sollte – einkaufen, Besuch des Musée Grévin, um mir die neue Ausstellung altchinesischer Kalligrafien anzuschauen oder einen letzten Blick auf die Kykladenköpfe im Louvre zu werfen. Aber ich ging wie betäubt weiter, an Châtelet vorbei, besah mir jeden Trödelladen entlang des Quai , ganze Straßenzüge voller Sportartikel, teurer tropischer Vögel und Zierfische, und wieder auf der anderen Seite des Flusses angekommen, empfand ich plötzlich die Sinnlosigkeit dieses ganzen Vergnügens, dazu noch der schöne blaue Himmel, und beim Anblick von Frauen, die mit ihren kleinen Kindern von den Spielplätzen heimkehrten und vor Metzgerläden und Bäckereien Grüppchen bildeten, stiegen jäher Zorn und Ungeduld in mir auf. Raffte mich zu der unumgänglichen Touristen-Flussfahrt auf der Seine bei Sonnenuntergang auf, die Fähre war vollgepackt mit irgendeiner deutschen Jugendgruppe, der »Pfadfinder«. Und jetzt wird’s Zeit.
Verzeih mir diesen verspäteten und eiligen Schrieb; ich wollte ihn eigentlich schon früher abgeschickt haben; jetzt kann ich ihn ebenso gut am Flughafen einwerfen. Habe noch keine Ahnung, was ich in meinem Vortrag über Spinoza sagen werde. Verlass’ mich ganz auf den Genius loci. Es ist meine erste Reise nach Amsterdam.
Alles Liebe, Sophie
Wenn sie verreiste, führte Sophie Blind alles, was sie in etwa 35 Jahren angesammelt hatte, mit sich in Kisten, Kästen, Koffern, Frachtkartons usw. Nicht persönlich, auch nicht unbedingt als Reisegepäck. Sie selbst trug nur das Nötigste bei sich, was von der Art der Reise – ob per Schiff, Bahn oder Bus, mit dem Flugzeug oder zu Fuß –, von Reisedauer und Ziel und letztlich von der Anzahl der Mitreisenden abhing.
Es leuchtete ihr ein, so mit den Dingen umzugehen: packen, auspacken, neu packen, wenn man wieder verreiste, und Sophie Blind war ihr ganzes Leben gereist. Als sie heiratete, setzte sie das Reisen an der Seite ihres Mannes fort. Ezra Blind arbeitete an einem Buch, welches ihn wahrscheinlich sein ganzes Leben lang beschäftigen würde, zumindest aber für die nächsten zwanzig Jahre; seine Arbeit machte Bibliotheksbesuche und Treffen mit Wissenschaftlern vieler Länder erforderlich. Glücklicherweise gelang es Ezra, von guten Universitäten beidseits des Atlantiks und sogar nach Jerusalem als Gastprofessor eingeladen zu werden. So hatten sie in vielen Städten gelebt, manchmal nur für wenige Monate, manchmal sogar zwei Jahre lang, und hatten zwischendurch auch andere Reisen unternommen. Sophie reiste gern. Sie führte immer gern einige liebgewonnene Gegenstände mit sich, liebte es, ein paar vertraute Dinge um sich zu haben, wo immer sie sich gerade aufhielt, abgesehen von dem mehr oder minder gleichbleibenden Himmel mit seiner ewiggleichen Sonne und seinem Mond und den sich mehr oder weniger gleichenden Wänden. Sophie reiste gern. Sophie hatte sich anstelle des Pelzmantels als Hochzeitsgeschenk von ihrem Schwiegervater eine Verlängerung ihrer Hochzeitsreise gewünscht. Einen Pelzmantel nicht haben wollen? Ihre Schwiegertochter musste aber einen Pelzmantel haben. Der Pelz, der bei der Geburt eines Sohnes erstanden wurde, war für die jeweiligen Familienfotos. Sie trug den Mantel für die Familie. Sie war schließlich ihre Schwiegertochter. Aber musste sie den Mantel auf all den Reisen mitnehmen, die sie mit ihrem Mann unternahm? Sie musste es, weil Ezra ihn mitbezahlt hatte. Sein Vater hatte gesagt: »Ich will für Sophie einen Fünfhundertdollarmantel kaufen.« Ezra sagte: »Kauf ihr einen für siebenhundert Dollar. Ich kenne jemanden, der uns einen Neunhundertdollarmantel für siebenhundert beschafft. Ich zahle die zweihundert, wir sparen vierhundert, und Sophie hat den besten Mantel.« Wenn sie mit Ezra zusammen war, trug Sophie den Pelzmantel und den Schmuck, den Ezra ihr kaufte. Jedes Mal, wenn Ezra um ihre Zukunft bangte, kaufte er Sophie einen schweren Silberschmuck.
Es gefiel ihm, wenn sie Schwarz trug. Sie hatte Schwarz getragen, als er ihr seinen Antrag machte, es stand ihr am besten und passte auch am besten zu dem Schmuck, den er für sie kaufte. Er kaufte Sophie jederzeit gern ein neues schwarzes Ausgehkleid. Ein gutes Schwarzes hat man fürs Leben. Was Sophie sich erträumte, war ein weißes Nachthemd, lang und weich, aus feinstem Batist oder Flanell. Aber Ezra konnte nicht verstehen, warum sie so etwas wollte. Nacktheit stand ihr besser. Manchmal wollte er, dass sie mit dem Pelzmantel ins Bett kam. Ein Nachthemd? Das war ein Luxus.
Nicht alles, was Sophie laufend sammelte, konnte ihr in Kisten und per Frachtladung in Kartons und Schrankkoffern folgen: das war schwierig, teuer und kompliziert.
Außerdem, wenn sie in südliche Länder zogen, brauchten sie nicht all ihre Mäntel und Wollsachen, obwohl vielleicht im nächsten Jahr oder irgendwann in der Zukunft, denn sie wussten nie, wohin sie als Nächstes ziehen würden. Ebenso hob sie zu klein gewordene Kinderkleidung auf, die sie für das nächste Kind würde brauchen können. Natürlich konnte sie das meiste von dem, was sie unterwegs gesammelt hatte, nicht mit sich führen, sondern verstaute es bei sesshaften Freunden und Verwandten, je nachdem, wo sie sich gerade aufhielten. Alles musste im Hinblick auf eine Zeit verwahrt werden, in der sie sich endgültig niederzulassen gedachte und ein großes Haus mit vielen Stockwerken und Flügeln besitzen würde, mit einem Keller zum Speichern und einem Dachboden für all die Haustiere, die sie ihren Kindern versprochen hatte. In ihrem Kopf bestand das alles schon, sie befand sich immer in dem Haus ihrer Einbildung, traf Vorbereitungen für eine Reise und suchte ein paar Sachen zusammen, die sie mitnehmen wollte. Aber vielleicht wünschte sie sich im Grunde nur dieses imaginäre Haus, und sie würde immer so weitermachen: reisen und Dinge sammeln und überall wohnen. Mittlerweile kam sie ganz gut damit zurecht, brachte hier eine Kiste, dort einen Koffer bei etablierten Freunden oder Verwandten unter. Wenn sie dann über ein Jahr lang an einem Ort wohnhaft war, konnte sie sich bestimmte Dinge zuschicken lassen, obwohl es ja nie endgültig war. Sie wünschte sich immer, es im Voraus wissen und im Hinblick auf künftige Umstände packen zu können.
Читать дальше