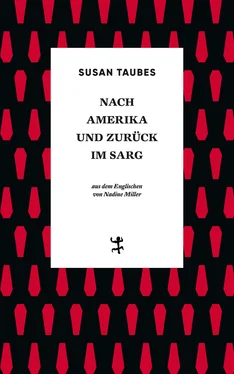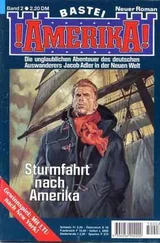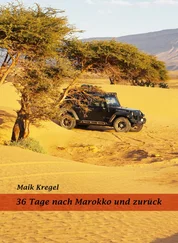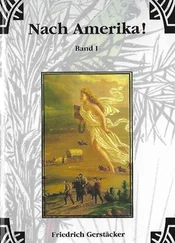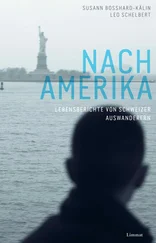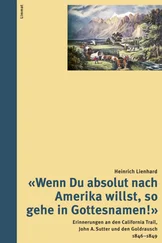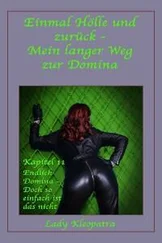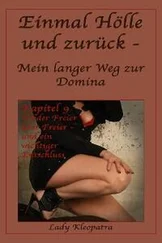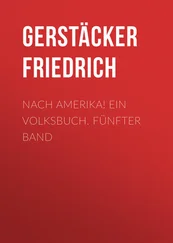Denn ein Kurzschluss zwischen Roman und Leben, zwischen Autobiografie und Herkunftsdiskurs ist für jüdische Autoren so prekär wie für Schriftstellerinnen, insofern er einer nahezu unausweichlichen Fixierung auf Identität in die Hände spielt. In den Jahren, in denen Divorcing und Malina erschienen, mussten Schriftstellerinnen noch damit rechnen, dass sich der Literaturbetrieb ihre Werke vom Halse hielt, indem sie als »lady novelists« abgekanzelt wurden. So die damalige vernichtende Kritik von Divorcing durch den bekannten Kritiker Hugh Kenner in der New York Times Book Review . Die Tatsache, dass New York Review Books kürzlich in ihrer Reihe »Classics« eine Neuauflage des Romans publiziert haben, zeigt dass diese Art Ressentiments heute glücklicherweise nicht mehr tonangebend sind. Dass darüber aber über ein halbes Jahrhundert vergangen ist, zeugt zugleich davon, welche Widerstände gerade literarisch anspruchsvolle Texte von Schriftstellerinnen, die keine einfachen Opfergeschichten oder Heldenmythen präsentieren, zu überwinden hatten.
Es ist kein Zufall, dass der einzige Teil des Romans, den Hugh Kenner positiv hervorhebt, das dritte Kapitel ist, das von der Kindheit in Budapest erzählt: bis zur Trennung der Eltern und zur Emigration gemeinsam mit dem Vater in die USA, dem »Tag, an dem alles anders wurde«. Taubes durchbricht hier das Muster von Kindheitserinnerungen, indem das Sentiment eines Blicks zurück konterkariert: im Gegeneinander zwischen einem sentimentalen Begehren, das durch die Stimme des Vaters vertreten wird – »Papi redete gern von den Dingen, die Sophie tat, als sie noch in einem Apartmentgebäude in Pest, auf der anderen Flussseite, wohnten« – und dem schwierigen Vorhaben, Perspektive und Sprache des Kindes zu vergegenwärtigen: »Es war für Sophie Blind ein seltsames Unterfangen, darüber zu schreiben, wie es als Kind in Budapest war. Die Person, die es hätte schreiben sollen, war nicht da, nicht so, wie sie jetzt da war. Sie schrieb auf Englisch in einem Apartment in New York. Das Kind befand sich in einem anderen Land, in einer anderen Sprache.«
Die historische und personelle Distanz der Schreibenden zum Gegenstand der Erzählung wird hier durch die Differenz der Orte und Sprachen verschärft. Aus einer mehrfachen Differenz heraus – damals-heute, Budapest-New York, ungarisch-englisch – wird der »Doppelverlust einer Welt und einer Person, die dieser Welt angehörte«, beschrieben. »Der Tag, an dem alles anders wurde«, gibt dem zuvor fraglosen Bewusstsein, Jüdin zu sein, eine neue, feindliche Bedeutung: »Und all dies sollte für sie die Bedeutung verlieren, weil sie Jüdin war!« Es geht um die Enteignung einer ohnehin fragilen Zugehörigkeit, die das Kind von seiner heimischen Fremdheit in der Welt des osteuropäischen säkularisierten Judentums abtrennt: »Religion war peinlich, aber man war stolz darauf, jüdisch zu sein. Warum? Der Vorzug, ein Jude zu sein, war für alle so offensichtlich, dass Sophies Frage in der Familie völlig sprachlose und missbilligende Blicke auslöste. Juden waren anders als andere Leute, konnte sie das denn nicht sehen?«
Mit dem Tag, an dem alles anders wurde, hat dieses Anderssein seine Unschuld verloren. Während es zuvor Zugehörigkeit zur anderen Kultur inmitten der Mehrheitskultur bedeutete, führt es nun zur Aberkennung von Zugehörigkeit überhaupt. Aus dieser Position heraus, von jenseits des Bruchs, hat jeder Rekurs auf ein Genre, das sich im Muster von Herkunft und Entwicklung bewegt, seinen Geltungsanspruch eingebüßt. Das Genre kann allenfalls noch zitiert oder in seiner Zwangslogik vorgeführt und entstellt werden. Beispielsweise in jener Szene, deren Sprache zwischen den Schauplätzen von Konferenz, Tag des Gerichts, Einwanderungsbehörde und Morgue wechselt:
»Sie wollen, dass ich Zeugnis ablege. Hier ist alles hervorragend organisiert. Mein Kopf liegt weit weg auf dem Tisch des Präsidenten. Liest die Zeitung. Ein Fehler, wenn man glaubt, Gott sei altmodisch. […]
Aus meinem Mund kräuseln sich kilometerlange Lochstreifen. Der ganze Boden ist davon bedeckt. […] Es ist unwichtig; trotzdem könnten Sie doch die Gefälligkeit haben, mich zu übersetzen […]
Sie haben doch all meine Papiere, Pass, carte de séjour , Versicherungspolice, Einbürgerungsurkunde, Geburtsurkunde, Volksschulzeugnisse und medizinische Untersuchungsergebnisse, Röntgenbilder des Brustkastens, Sie haben meinen Körper – können dessen Zustand besser beurteilen, als ich es kann –, fast hätte ich meine Veröffentlichungen vergessen, die Seminararbeiten, Dissertation usw., in der Kartei. Lassen Sie Ihren Sekretär nach dem Koffer suchen, in dem sich all meine Aufzeichnungen befinden und der – bei wem? – hinterlegt ist … Sie können von mir nicht erwarten, dass ich mich an alles erinnere. Ich muss wiederholen, ich habe nichts Persönliches anzugeben, alles über mich ist öffentlich, es liegt Ihnen vor. […]
[W]as die eigentlichen Erinnerungen betrifft, die Sie angefordert haben, die Originalprägung kann nicht entfernt werden. Alles, was ich Ihnen hier sage, die Worte, meine Herren, die Sprache selbst ist ein Geschenk von Ihnen; ich danke Ihnen dafür, zutiefst verpflichtet, Ihre ergebene Tochter usw.«
Hier spielt die Autorin nicht nur auf die vorgeprägte Sprache der autobiografischen Rede und deren Verbindung zum religiösen Geständnis und polizeilichen Fahndungsdiskurs an. Sie thematisiert auch in ungewöhnlicher Weise das Verhältnis von öffentlicher und verborgener Person, von offener und versteckter Schrift. Während Bachmann in ihrem Roman Malina die Ich-Erzählerin, eine Schriftstellerin, vor ihrem Verschwinden ein Versteck für ihre Liebesbriefe suchen lässt, um diese in ihren Hinterlassenschaften vor dem Blick des Erzählers zu verbergen, scheint sich das Verhältnis von versteckten und öffentlichen Schriften für Susan Taubes’ Hauptfigur anders darzustellen. Denn es sind offensichtlich gerade ihre Veröffentlichungen, die vergessen wurden, während ihr Persönliches bereits der Öffentlichkeit preisgegeben war. »Ich habe nichts Persönliches anzugeben, alles über mich ist öffentlich.«
Dieser Satz verweist auf den Autornamen Taubes und die Konnotationen, mit denen er besetzt ist – noch vor jedem Roman. Durch ihre Ehe mit dem berühmten und streitbaren Religionsphilosophen Jacob Taubes war ihr Name nicht neutral und ihr Privatleben nicht unbekannt. Die Theatralität in der Schreibweise von Susan Taubes’ Roman gilt – neben der Reflexion vorgeschriebener Rituale, Rollen und Szenen – auch der Darstellung eines Lebens, das partiell auf der Bühne stattfand.
Susan Feldmann, die 1928 geborene Enkelin des Oberrabiners von Budapest, die 1939 zusammen mit ihrem Vater, einem Psychoanalytiker, in die USA emigriert war, hat während ihres Philosophiestudiums den fünf Jahre älteren, in Wien geborenen und 1936 nach Zürich übersiedelten, promovierten Philosophen und Rabbiner Jacob Taubes kennengelernt und ihn 1949, als sie einundzwanzig war, geheiratet. 1961, zwölf Jahre später, als ihre beiden Kinder acht und vier Jahre alt waren, hat sie sich von ihm getrennt. Bevor sie sich dem literarischen Schreiben zuwandte, war die Philosophin als Lehrende aktiv. Susan Taubes lehrte nach Abschluss ihrer Dissertation über Simone Weil von 1957 bis 1964 Religionsphilosophie an der Columbia University in New York und veröffentlichte in dieser Zeit zahlreiche Beiträge über negative Theologie, Gnosis, Philosophen wie Heidegger und Nietzsche, die griechische Tragödie und zeitgenössisches Theater. Von ihren literarischen Texten wurde zu Lebzeiten nur weniges veröffentlicht, während ihre umfangreichen Hinterlassenschaften zahlreiche Erzählungen, Gedichte und Fragmente enthalten, u. a. das Fragment eines zweiten Romans, der inzwischen in deutscher Übersetzung in dem Band Prosa vorliegt.
Читать дальше