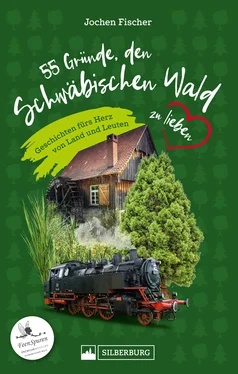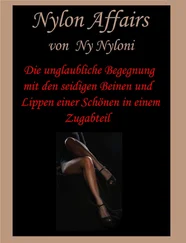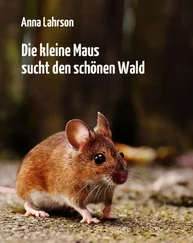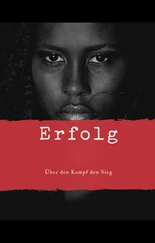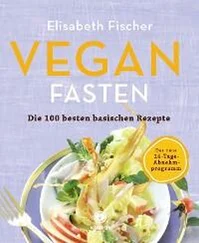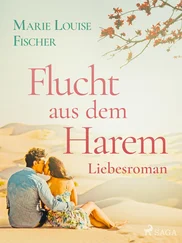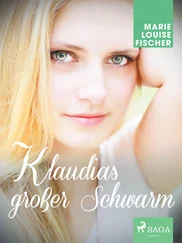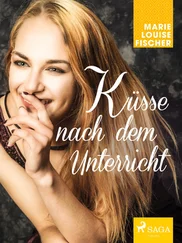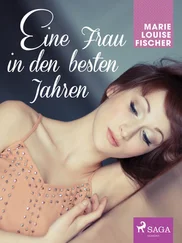Georg Kropp warb Mitglieder für seine »Gemeinschaft der Freunde«, wie der Sparverein heißen sollte. Er war christlich geprägt, sollte aber weltanschaulich neutral sein. Im Mai 1921 fand in Stuttgart – unter konsequenter Alkoholabstinenz – die Gründungsversammlung statt, mit dem Ziel, »auf rein gemeinnütziger, bodenreformerischer Grundlage die Schaffung von Wohngelegenheiten und Altersheimen für die Allgemeinheit« zu organisieren. Die gute Idee traf auf eine ungute Zeit: Deutschland erlebte die erste große Inflation. Bei Geldentwertung war an zielgerichtetes Sparen nicht zu denken. Kropp und seine Mitarbeiter zahlten die eingegangenen Beiträge – teils aus eigenem Vermögen – zurück und hofften auf bessere Zeiten. Diese zogen im Frühjahr 1924 auf. Die Mitgliederwerbung lief wieder an, und Kropps Haus in Wüstenrot wurde über Nacht zur Zentrale der »Bausparkasse der Gemeinschaft der Freunde«. Bis 1925 waren fast 10 000 Bausparverträge abgeschlossen, und der Name Wüstenrot wurde in ganz Württemberg bekannt.
1928 verlegte die Bausparkasse gegen den Willen des Gründers die Firmenzentrale nach Ludwigsburg. Nur im Markennamen ist Wüstenrot bis heute erhalten geblieben. Auch das erste Haus der Familie Kropp in der Haller Straße 3 steht noch und ist heute das Wüstenroter Bausparmuseum. Das Haus ist klein, die sehenswerte Ausstellung ebenso. Vom Museum aus lässt sich ein bauspargeschichtlicher Rundweg durch den Ort erkunden. Er verbindet Gebäude, die mit der Historie der Sparkasse zu tun haben – vom Häusle eines der ersten Sparer bis zur schmucken Villa, die sich Georg Kropp 1926/27 bauen ließ. Lohnenswert ist auch ein Abstecher zum ebenfalls kleinen, feinen Glasmuseum im Alten Rathaus.
Berglen: die doppelte Schönheit

Die Gemeinde und die Landschaft, in der sie liegt, tragen den gleichen Namen: Berglen. Die Gegend ist gewissermaßen ein Schwäbischer Wald en miniature: bewaldete Höhen, Hochebenen mit Äckern, gewässerreiche Täler, verstreute Siedlungen und vereinzelte Bauernhöfe. Als Verwaltungseinheit ist Berglen vor etwa 50 Jahren durch die baden-württembergische Gemeindereform entstanden. Zuvor hatten die neun Teilgemeinden ihr jeweils eigenes Bürgermeisteramt mit allem, was man so braucht, um seine Bürger zu versorgen und zu verwalten. Nach diesem Muster in den 1970er-Jahren neu formierte Gemeinden findet man überall am und im Schwäbischen Wald: von Alfdorf, Aspach und Auenwald bis Weissach im Tal.
Als Landschaft hießen die Berglen – der Artikel macht den feinen Unterschied zum Gemeindenamen – schon lange so. Der Name beschreibt sehr schön, was man dort findet. Der schmale südwestliche Ausläufer des Schwäbischen Walds ist zwischen 300 und knapp unter 500 Meter hoch – keine Berge also, sondern Berglen. Und doch ist die sanfte Hügellandschaft schon fast so hoch wie die im Norden und Osten anschließenden Berge, die zwischen 500 und knapp 590 Meter in den Himmel ragen. Die Ausblicke, die man von den Hochebenen hat, müssen sich nicht hinter denen des Schwäbischen Walds verstecken. Befährt man etwa das gewundene Sträßchen zwischen den Ortsteilen Kottweil und Birkenweißbuch, dann schaut man auf den Rücken des Schurwalds auf der gegenüberliegenden Seite des Remstals, aber auch weit ins Land zur Ostalb mit den drei Kaiserbergen Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen.

Ländlich ist es in den Berglen. Es gibt viel Landwirtschaft, deren Produkte in kleinen Hofläden angeboten werden. Eine Sache macht Berglen ganz besonders: Die Gemeinde gilt als die an Streuobstwiesen reichste Kommune weit und breit. Wer blühende Landschaften liebt, wird im Frühling von den Tälern und Hügeln um Oppelsbohm und Rettersburg reich verwöhnt. Der fast allgegenwärtige Anbau von Äpfeln und Birnen, Kirschen und Zwetschgen hat allerdings als Notlösung begonnen. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kultivierte man in den Berglen Wein. Nachdem vor mehr als 150 Jahren eingeschleppte Mehltaupilze und die amerikanische Reblaus den Weinbau in ganz Europa verheert hatten, sattelten die Bauern in den Berglen um. Aus den Weinbergen wurden Obstgärten, Hauptprodukt war das schwäbische Nationalgetränk Most. Den eigenen Wein hatte man zuvor ohnehin kaum getrunken, er war eine lukrative Handelsware. Apfelmost ist ein wenig aus der Mode gekommen, doch man kann ihn in den Berglen noch bekommen. Wer Säfte aus den Streuobstwiesen mag, schöpft aus dem Vollen: Fast in jedem Ort gibt es sie direkt vom Produzenten, ebenso Destillate aus Kern- und Steinobst. Mehr zur Geschichte des Obstanbaus in den Berglen lässt sich im Teilort Hößlinswart im Gehölzgarten sowie auf dem 2,6 Kilometer langen Obst- und Gehölzeweg in Bretzenacker entdecken, der mehr als 200 Sorten mit informativen Tafeln erklärt. Wer sich mehr Zeit für die schöne Landschaft nehmen möchte, findet auf der Website von Berglen acht Genießertouren zwischen 2,6 und 10,9 Kilometern Länge.
» www.berglen.de/de/erleben-entdecken/berglen-aktiv/wandergebiet-berglen
Eberhard Bohn: der Mühlendoktor

Eigentlich müsste man ihm ein Denkmal setzen. Und wenn, dann müsste es eine Mühle sein. Doch es wäre ihm nicht recht. Schon gar nicht zu Lebzeiten. Eberhard Bohn, geboren 1935, ist der Letzte seines Standes im Schwäbischen Wald: Er hat in jungen Jahren das Handwerk des Mühlenbauers gelernt.
»Die Leute meinen immer, das Mühlrad sei gleichbedeutend mit der Mühle«, sagt er knitz und milde lächelnd, wie es seine Art ist. Es stecke aber viel mehr Technik in einer Mühle: Förderanlagen für das Getreide, Einrichtungen zum Reinigen und Sortieren und selbstverständlich die komplizierten Mahlwerke. All das konnte er bauen. Allerdings kamen kleine Mühlen, wie er sie bauen konnte, aus der Mode, kaum dass er ausgelernt hatte. »Es gab in den 1950er-Jahren Programme der Bundesregierung, die das Stilllegen kleiner Mühlen finanziell belohnten«, erzählt er. »Man setzte alles auf Großmühlen, die in einer Stunde schafften, wofür ein kleiner Müller ein Jahr lang schuften musste.« Eberhard Bohn, der gemeinsam mit seinem Vater in Kirchenkirnberg bei Murrhardt den Mühlenbau betrieb, sattelte um: Man stellte nun landwirtschaftliche Siloanlagen her. »Mein Berufsleben hatte eigentlich kaum mit Mühlen zu tun, und doch kennen mich die Leute heute hauptsächlich als den Mühlenbauer.«
Denn an fast jede der Mühlen, die heute im Schwäbischen Wald noch funktionsfähig sind, hat er seine fachmännische Hand angelegt. Nachdem die Mühlen als Erwerbsquellen ausgedient hatten, sind die meisten in Vergessenheit geraten. Als man ihren Denkmalwert entdeckte, waren sie mehr oder minder hinüber. Da gab es im Schwäbischen Wald nur einen, der helfen konnte: Eberhard Bohn. Das hat er gern getan, immer in seiner Freizeit und mit vielen ehrenamtlichen Helfern, die die alte Technik noch verstanden haben. Dass man ihn Mühlendoktor nennt, damit kann er leben. »So haben die Menschen hier in der Gegend den Mühlenbauer genannt, wenn er kam, um eine Mühle zu reparieren«, sagt er. Man braucht wohl tatsächlich ein diagnostisches Gespür, um im komplizierten Räderwerk herauszuhorchen, wo es den Patienten zwackt und wo es klemmen könnte.
Als er noch jünger und fitter war, hat man ihn aus ganz Deutschland um Hilfe beim Restaurieren von Mühlen oder dem Bau von Wasserrädern gerufen. Dass es heute im Schwäbischen Wald einen jährlichen Mühlentag gibt, ist zu einem großen Teil seiner Initiative zu verdanken. Aus Altersgründen kann er heute nicht mehr selbst Hand anlegen beim Bau von neuen Rädern für alte Mühlen. Gut zwei Dutzend sind nach seinen Plänen entstanden, als er noch jünger war. Immerhin kann er noch Rat geben, wenn es irgendwo klemmt. Und fuchtig werden, wenn es die Jungen trotz seiner präzisen Erklärungen nicht hinbekommen.
Читать дальше