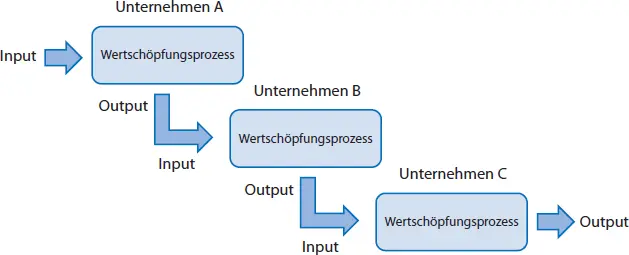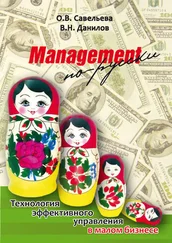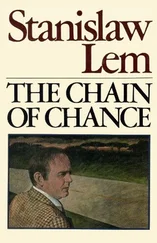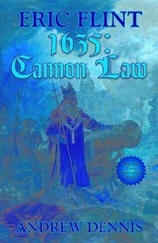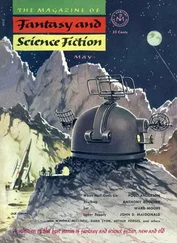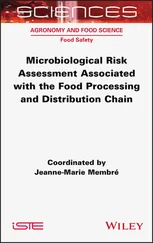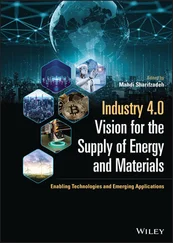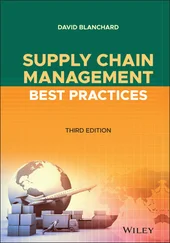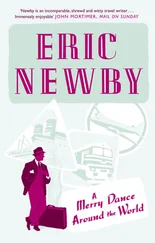Anstatt des korrekten Begriffs Wertkette wird für den von Porter verwendeten Begriff Value Chain häufig die fälschliche Übersetzung Wertschöpfungskette verwendet (Pibernik, 2001). Diese unglückliche Verwendung findet sich z. B. bei Hahn (1996, S. 411). Entsprechend wird der Begriff Value als Wertschöpfung bezeichnet und nicht als Wert. So findet sich bei Porter (1985, S. 38): »A firm is profitable if the value it commands exceeds the costs involved in creating the product.« In der Übersetzung (Porter 2014, S. 66) findet sich dann: »Ein Unternehmen arbeitet gewinnbringend, wenn seine Wertschöpfung über den Kosten für die Erstellung des Produktes liegt.« Auch wenn beide Aussagen richtig sind, wird doch eine inkorrekte und verwirrende Verwendung der Begriffe Wert (value) und Wertschöpfung (vaue added) bekräftigt.
Sowohl das Konzept der Geschäftsprozesse (Gaitanides, 1996) als auch das Konzept der Wertaktivitäten (Porter, 1985) fokussieren den Output in Form des durch einen Prozess geschaffenen Wertes ohne den dafür notwendigen Input zu berücksichtigen (Pibernik, 2001). Zur Abbildung der sich in Unternehmen vollziehenden Prozesse bietet es sich deshalb an, das Konzept der Wertschöpfungsprozesse heranzuziehen, welches aufgrund der expliziten Berücksichtigung des Prozessinputs über das Konzept der Geschäftsprozesse hinausgeht (  Abb. 1-17).
Abb. 1-17).
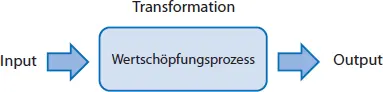
Abb. 1-17: Wertschöpfungsprozess
Ein Wertschöpfungsprozess (oder eine Wertschöpfungsprozesskette) ist »[…] any activity or group/series of activities that takes an input, adds value to it, and provides an output to an internal or external customer« (Harrington,1991, S. 9). Die Wertschöpfung (value added) eines Wertschöpfungsprozesses bezeichnet dann den Wert, der dem Gesamtwert der Vorleistungen durch den betrachteten Wertschöpfungsprozess hinzugefügt wird (Weber, 1993).
2.1.1 Operationalisierung der prozessbezogenen Wertschöpfung
Wertschöpfungsprozesse lassen sich formal darstellen. Damit gelingt es, Wertschöpfung prozessbezogen zu operationalisieren (Pibernik, 2001, S. 144-147). Ein Wertschöpfungsprozess pr transformiert die Quantitäten  der Inputfaktoren i = 1, …, n in die Quantitäten
der Inputfaktoren i = 1, …, n in die Quantitäten  der Outputs j = 1, …, m. Das bedeutet, der Wertschöpfungsprozess pr transformiert den Inputvektor
der Outputs j = 1, …, m. Das bedeutet, der Wertschöpfungsprozess pr transformiert den Inputvektor
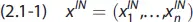
in den Outputvektor
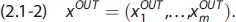
Zur Bestimmung der Wertschöpfung sind aus den Inputfaktoren jedoch jene zu isolieren, welche Vorleistungen darstellen, d. h. es ist nur der Teil des Vektors in (2.1-1) zu berücksichtigen, der die Vorleistungen repräsentiert:
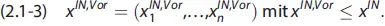
Die Vektoren 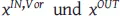 bilden ein Mengengerüst, welches zu bewerten ist. Hierzu wird angenommen, dass für alle Vorleistungen ein Bezugspreis
bilden ein Mengengerüst, welches zu bewerten ist. Hierzu wird angenommen, dass für alle Vorleistungen ein Bezugspreis  und für jeden Output ein Preis
und für jeden Output ein Preis  angegeben werden kann (Wertgerüst). Die Wertschöpfung des Prozesses pr ergibt sich dann als Differenz des Werts des Prozessoutputs
angegeben werden kann (Wertgerüst). Die Wertschöpfung des Prozesses pr ergibt sich dann als Differenz des Werts des Prozessoutputs  und des Werts der Vorleistungen
und des Werts der Vorleistungen  dieses Prozesses (
dieses Prozesses (  Abb. 1-18):
Abb. 1-18):
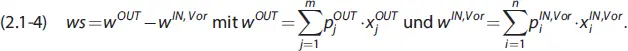
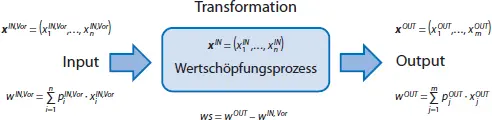
Abb. 1-18: Operationalisierung der prozessbezogenen Wertschöpfung
Das folgende einfache Beispiel illustriert diesen Zusammenhang (Burda/Wyplosz 2009, S. 35). Betrachten wir wieder die mittelständische Brauerei aus unserer Bier-Supply Chain (  Abb. 1-2). Für die Produktion eines Fasses Bier hat die Brauerei c. p. folgende Vorleistungen bezogen: Hopfen, Malz und Hefe von Rohstofflieferanten für 15 €, Strom und Wasser der Stadtwerke für 5 € sowie das Fass für 15 € von einem Verpackungshersteller, d. h.
Abb. 1-2). Für die Produktion eines Fasses Bier hat die Brauerei c. p. folgende Vorleistungen bezogen: Hopfen, Malz und Hefe von Rohstofflieferanten für 15 €, Strom und Wasser der Stadtwerke für 5 € sowie das Fass für 15 € von einem Verpackungshersteller, d. h. 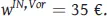 Das Bierfass Bier wird von der Brauerei für
Das Bierfass Bier wird von der Brauerei für  € an einen Getränkegroßhändler verkauft. Die Brauerei hat mit diesem Bierfass eine Wertschöpfung von
€ an einen Getränkegroßhändler verkauft. Die Brauerei hat mit diesem Bierfass eine Wertschöpfung von 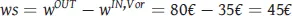 geschaffen.
geschaffen.
2.1.2 Betriebliche Wertschöpfung
Verlassen wir die Prozessebene und begeben uns auf die Unternehmensebene. In einer arbeitsteiligen Wirtschaft wird von einem einzelnen Unternehmen ein Wert dadurch geschaffen, dass es Güter von anderen Unternehmen zu einem bestimmten Preis übernimmt (Input), mit diesen Gütern neue Güter herstellt (Output) und diese anschließend zu einem höheren Preis auf einem Markt absetzt (  Abb. 1-19). Produktbezogen entstehen unternehmensübergreifende Wertschöpfungsprozessketten (oder -netzwerke).
Abb. 1-19). Produktbezogen entstehen unternehmensübergreifende Wertschöpfungsprozessketten (oder -netzwerke).
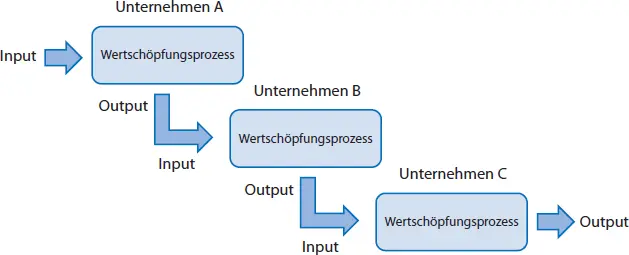
Abb. 1-19: Betriebliche Wertschöpfung
Die Höhe der betrieblichen Wertschöpfung bemisst sich als Differenz aus dem Marktwert der vom Unternehmen hervorgebrachten Güter und der Kosten der von anderen Produzenten beschafften Materialien und Leistungen (Ruggles/Ruggles, 1956 sowie Rutherford, 1977). Die betriebliche Wertschöpfung (value added) kann demnach »[…] generell erklärt werden als die Differenz zwischen dem Wert der vom Betrieb übernommenen Güter und dem Wert der vom Betrieb abgegebenen Güter« (Weber, 1980, S. 10), d. h. »[…] Erträge minus Aufwendungen für Vorleistungen […]« (Hahn, 1996, S. 159). Die betriebliche Wertschöpfung ist somit eine Wertgröße (gemessen in Geldeinheiten); sie bezieht sich stets auf eine konkrete Zeitperiode (z. B. €/Jahr). Vereinfacht ergibt sich der in Abbildung 1-20 dargestellte Zusammenhang.
Читать дальше
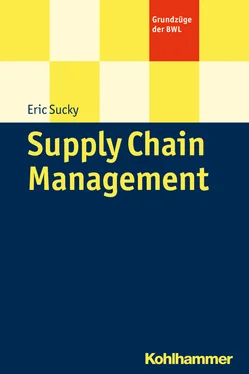
 Abb. 1-17).
Abb. 1-17).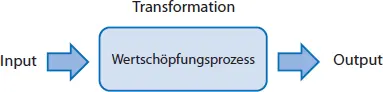
 der Inputfaktoren i = 1, …, n in die Quantitäten
der Inputfaktoren i = 1, …, n in die Quantitäten  der Outputs j = 1, …, m. Das bedeutet, der Wertschöpfungsprozess pr transformiert den Inputvektor
der Outputs j = 1, …, m. Das bedeutet, der Wertschöpfungsprozess pr transformiert den Inputvektor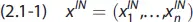
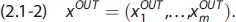
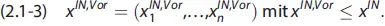
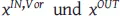 bilden ein Mengengerüst, welches zu bewerten ist. Hierzu wird angenommen, dass für alle Vorleistungen ein Bezugspreis
bilden ein Mengengerüst, welches zu bewerten ist. Hierzu wird angenommen, dass für alle Vorleistungen ein Bezugspreis  und für jeden Output ein Preis
und für jeden Output ein Preis  angegeben werden kann (Wertgerüst). Die Wertschöpfung des Prozesses pr ergibt sich dann als Differenz des Werts des Prozessoutputs
angegeben werden kann (Wertgerüst). Die Wertschöpfung des Prozesses pr ergibt sich dann als Differenz des Werts des Prozessoutputs  und des Werts der Vorleistungen
und des Werts der Vorleistungen  dieses Prozesses (
dieses Prozesses ( 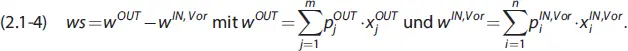
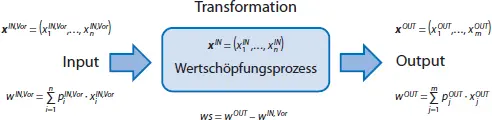
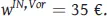 Das Bierfass Bier wird von der Brauerei für
Das Bierfass Bier wird von der Brauerei für  € an einen Getränkegroßhändler verkauft. Die Brauerei hat mit diesem Bierfass eine Wertschöpfung von
€ an einen Getränkegroßhändler verkauft. Die Brauerei hat mit diesem Bierfass eine Wertschöpfung von 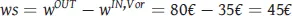 geschaffen.
geschaffen.