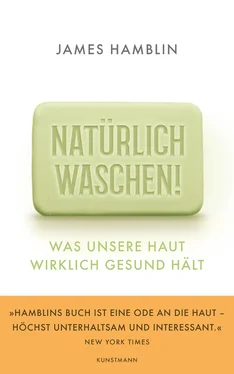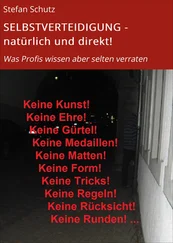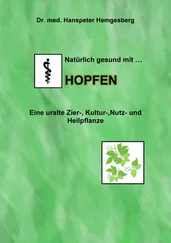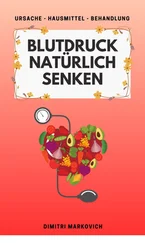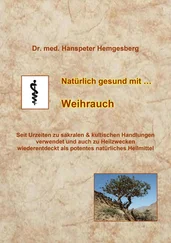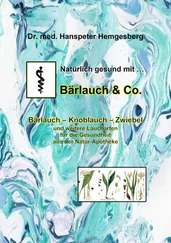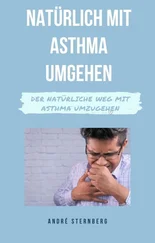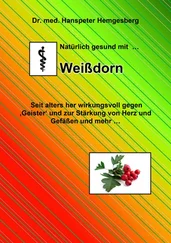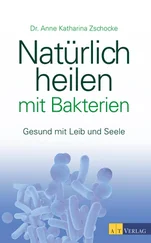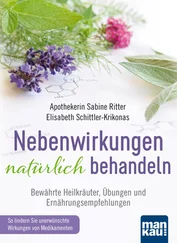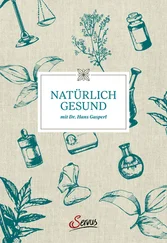Auch wenn der Gedanke an Milben den meisten wohl kaum behagt, wäre es vermutlich weitaus schlimmer, gar keine zu haben. Und welches Merkmal könnte im Übrigen näher an die Definition von »normal« herankommen als eines, das auf 100 Prozent der Menschen zutrifft? Da muss es einen guten Grund für die Milben geben. Oder etwa nicht?
Michelle Trautwein, Professorin für Dipterologie (Fliegenkunde) an der California Academy of Sciences und Co-Autorin der genannten Studie, erkennt in den Milben die Schönheit des Lebens: »Sie sind ein universaler Bestandteil unseres Menschseins.« Insektenkundler*innen wie Trautwein gehen gemeinsam mit Dermatolog*innen und Ökolog*innen der Frage nach, warum wir Milben besitzen, und entdecken dabei neue Wahrheiten über uns. Zum einen: Der Mensch ist kein autarkes Lebewesen, er ist auf andere Organismen, die auf ihm und um ihn leben, angewiesen.
Die Milben, so Trautwein, ernähren sich vermutlich von unseren toten Hautzellen und wären damit die »natürlichste« Peelingmethode. Außerdem verringern sie wohl auch den Staub in unseren Wohnungen, der zum Teil aus Hautzellen besteht. Dennoch würde uns jedes Produkt im Drogeriemarkt oder auf Instagram verlockend erscheinen, das uns verspricht, uns von den Gesichtsmilben zu befreien.
Auch wenn wir alle Milben im Gesicht haben, kann ihre anormale Vermehrung oder eine anormale Reaktion auf ihre Vermehrung nachweislich zu Hautkrankheiten führen. So besteht etwa, wie eine kürzliche Auswertung von achtundvierzig Studien ergab, ein Zusammenhang zwischen Milbendichte und Rosazea. Wie bei anderen Erkrankungen mit Mikrobenbezug geht es dabei jedoch vor allem um Zahlenverhältnisse und den Kontext, nicht einfach um eine Invasion »böser« Lebewesen. Normalerweise ist die Milbe Demodex gutartig und offenbar sogar der Gesundheit förderlich. Doch wenn sich ihr Umfeld ändert, kann sie pathogen (krankheitsauslösend) werden. Ähnlich wie der Mensch selten mit der Neigung geboren wird, andere zu verletzen, aber im Krieg und mit einem Schießbefehl ohne Weiteres tötet.
Die Entdeckung der Milben und Billiarden anderer winziger Geschöpfe unseres Hautmikrobioms bedeutet das Ende der sogenannten »Keimtheorie«, der simplen Vorstellung also, wir müssten die Mikroben bekämpfen, um Krankheiten vorzubeugen. Das Bild ist bunter geworden. Die meisten Mikroben gelten inzwischen nicht nur als harmlos, sondern sogar als nützlich, wenn nicht gar überlebenswichtig. Das Ich und das Andere sind weniger eine Dichotomie als vielmehr ein Kontinuum.
Obwohl sich das menschliche Baby in einer sterilen Umgebung, der mikrobenfreien Gebärmutter, entwickelt, ist es nach Verlassen des Geburtskanals ein brüllender Bakterienschwamm, der sofort Mikroben aufliest, die seine Gesundheit und Überlebensfähigkeit fördern. Seine Haut wird von mütterlichen Bakterien besiedelt, von denen einige lebenslang in den Hautporen verbleiben und die Interaktion mit allen späteren Mikroben überwachen.
Ab diesem Zeitpunkt wird die Hautgesundheit vor allem zu einer Frage des Umfelds. Außenwelt und Haut beeinflussen die Mikroben, Mikroben und Körperfunktionen ihrerseits die Haut.
Die Forschungen zum Mikrobiom sind gerade im Begriff, unsere Grundannahmen der Hautpflege auf den Kopf zu stellen. Die Folgen sind alles andere als nebensächlich. Da ist etwa die kürzliche Studie des Dermatologen Richard Gallo von der University of California in San Diego. Sein Team bestrich eine Mäusegruppe mit dem Bakterium Staphylococcus epidermidis, das auch auf der menschlichen Haut vorkommt. Eine andere Gruppe säuberte man so gründlich, dass sie bakterienfrei war.
Dann verpasste man beiden eine schöne Bräune. Die Mäuse mit den Bakterien entwickelten seltener Hautkrebs. Laut Gallo erzeugt Staphylococcus epidermidis einen Stoff namens 6-N-Hydroxyaminopurin, der Krebszellen angreift und ihre Vermehrung verhindert.
Natürlich handelt es sich hier um eine erste Studie, und sie hat die Mikroben auch nur an Mäusen und nicht an Menschen erforscht. (Menschen UV-Licht auszusetzen, um zu sehen, ob sie Krebs entwickeln, wäre unethisch.) Doch ähnliche Studien werden derzeit offenbar im Wochentakt veröffentlicht. Zusammengenommen werfen sie zumindest die Frage auf, ob wir wirklich alle Hautbakterien so entschieden und willkürlich abwaschen sollten, wie man uns beigebracht hat.
Doch um das herauszufinden, müssen wir zunächst der Frage nachgehen, wie unsere heutigen Sauberkeitsvorstellungen überhaupt entstanden sind.
Val Curtis hat Fremden gern Bilder von verfaulten Nahrungsmitteln, von Würmern, Körperflüssigkeiten und Ähnlichem gezeigt und ihre Reaktionen dann aufgezeichnet.
Das war ihr Job. Curtis war eine weltweit führende »Ekelogin«, ehe sie im Herbst 2020 starb. In ihrer langen Laufbahn als Professorin an der London School of Hygiene and Tropical Medicine ging sie zu Beginn der Frage nach, warum Menschen sich – häufig aus einem innersten Bedürfnis heraus und mit großer Leidenschaft – um Sauberkeit bemühen.
Die Reaktionen auf die gezeigten Bilder waren, so Curtis, fast identisch, quasi universell, also unabhängig von Wohnort, Alter, Geschlecht und anderen erfassten Variablen. Die allgemein verbreitete Reaktion auf »dreckige, klebrige, tropfende, wimmelnde Gegenstände« bezeichnete sie in ihren Studien als »starkes Ekelgefühl«.
Aber was verbarg sich dahinter? Um das herauszufinden, arbeitete Curtis mit dem sogenannten Laddering-Verfahren aus der Marktforschung. Mithilfe der »kognitiven Leiter« kommt man tieferliegenden Motiven auf die Spur. Eigentlich eine einfache Fragetechnik, wie sie Dreijährige in aller Welt beherrschen: Warum, warum, warum? Wenn man einen Restaurantgast beispielsweise fragt: »Warum haben Sie diesen Salat bestellt?«, wird er vielleicht antworten: »Er hat sich gut angehört.« Fragt man aber weiter nach dem Warum, stößt man möglicherweise auf das komplexe Verhältnis, das wir zu Nahrungsmitteln haben, zur Sterblichkeit und unserem Wunsch der Kontrolle darüber. Das Laddering-Verfahren eignet sich für erste Dates genauso wie für die Forschung. Die Antworten auf Curtis’ Fragen liefen irgendwann immer auf dasselbe hinaus: »Ekel«.
»Dreck ist einfach ekelhaft. Schmodder ist einfach ekelhaft. Verdorbene Nahrung ist ekelhaft«, sagte sie in unserem Gespräch. »Weiter kam ich nie.«
Also machte sie sich daran herauszufinden, was diese Dinge gemeinsam hatten.
Ihr Büro verwandelte sich in eine Bibliothek zu ihrem Forschungsgegenstand, eine »riesige, kunterbunte Sammlung von allem, was die Menschen auf der Welt ekelhaft finden«, wie sie sagte. Und auf der Suche nach dem gemeinsamen Muster »stieß ich jedes Mal auf Krankheit«.
Ein ausgefallenes Haar etwa könne Kopfhautflechte übertragen. Und darum reiche schon ein einziges verirrtes Haar auf dem Teller, um ein Restaurant in Grund und Boden zu verdammen, nie wieder einen Fuß dort hineinzusetzen und den Küchenchef samt Familie auf ewig zu verfluchen.
Genauso könne Erbrochenes, das überall als ekelhaft gelte, ungefähr dreißig verschiedene Krankheiten übertragen.
Dabei ekeln wir uns offenbar nicht vor dem Leid an sich. Wenn jemand an Krebs stirbt oder einen Herzinfarkt hat, eilen wir ohne Zögern an seine oder ihre Seite. Doch der Anblick von Blut, Erbrochenem oder Fäkalien, so Curtis, löst bei uns eine instinktive Abwehr aus, die uns vor ansteckenden Krankheiten schützt.
»In unserem Alltag ist der Kontakt mit anderen vermutlich das Gefährlichste«, erläuterte sie, »der andere trägt den Bazillus in sich, der uns krank machen kann.«
So gesehen ist Ekel sehr nützlich. Wenn wir bei einem bestimmten Verhalten oder Aussehen Ekel empfinden, schützt uns das vor den Krankheiten der anderen. Darum ekeln wir uns auch manchmal vor uns selbst, schämen uns für unser Aussehen oder sind peinlich davon berührt. Wir wollen keinen Ekel erregen, weil wir sonst Gefahr laufen, sozial ausgegrenzt oder aus der Gemeinschaft verstoßen zu werden. Wert auf unser Äußeres zu legen, gehört also zu unserer Evolutionsgeschichte.
Читать дальше